Donald Trump hat einen Sündenbock für eine allfällige Niederlage im November ausgemacht: die briefliche Stimmabgabe. Doch die Mängel des US-Wahlsystems liegen anderswo.
Louis DeJoy ist nicht zu beneiden. Als Chef der US-amerikanischen Post muss er gewährleisten, dass alle Briefe pünktlich ankommen. Als Intimus von Präsident Donald Trump muss er zugleich erklären, dass ihm das womöglich nicht gelingt. Den lokalen Wahlbehörden teilte er bereits mit, dass Wahlkuverts nicht mehr automatisch prioritär behandelt würden.

Auf Gedränge beim Wählen haben dieses Jahr viele Amerikaner keine Lust. (Foto: Don Shall)
Bei den Wahlen am 3. November werden so viele US-Amerikaner ihre Stimme auf dem Postweg abgeben wie noch nie. 43 Gliedstaaten erlauben die briefliche Stimmabgabe allen Bürgern; in 9 davon werden die Wahlzettel für die briefliche Stimmabgabe automatisch allen (registrierten) Wählern zugesandt, in 34 muss zwar ein formeller Antrag gestellt, aber kein bestimmter Grund angegeben werden. Die restlichen 7 Staaten erlauben die briefliche Stimmabgabe nur unter bestimmten Bedingungen. Angesichts der Covid-19-Pandemie haben mehrere Staaten die Briefwahl erleichtert.
Zugleich ist die Briefwahl aber so umstritten wie noch nie. Trump argumentiert, dass sie Manipulationen Tür und Tor öffne, und prophezeite bereits die «ungenauesten und gefälschtesten Wahlen der Geschichte», sollte die briefliche Stimmabgabe allgemein erlaubt werden. Dass es bei der Briefwahl zu Problemen kommen kann, ist nicht von der Hand zu weisen. So kam es bei den Vorwahlen der Demokraten im Staat New York im Juni zum Chaos, nachdem die Wahlzettel zu spät verschickt worden waren und die Post die aufgegebenen Kuverts nur selektiv mit einem Poststempel versehen hatte. Es dauerte über einen Monat, bis das offizielle Resultat vorlag. Das stimmt wenig zuversichtlich für das ungleich grössere Unterfangen einer nationalen Wahl im November. Die Regeln und die Organisation der Wahlen sind in den USA stark dezentralisiert, und nicht überall dürften die Wahlbehörden der Gliedstaaten und Counties gleich gut vorbereitet sein auf die Masse der Briefstimmen.
Wochenlange Ungewissheit
Das Auszählen der Briefstimmen nimmt erfahrungsgemäss längere Zeit in Anspruch. In 14 Staaten darf damit erst am Wahltag begonnen werden. Mancherorts zählen Briefstimmen auch dann, wenn sie am Wahltag abgeschickt werden und erst Tage später beim Wahlbüro sind. Richard Hasen, Rechtsprofessor an der University of California in Irvine und Autor des Buches «Election Meltdown», befürchtet deshalb ein wochenlanges Ringen um die Auszählung im Nachgang der Wahlen.
Hinzu kommt: In der Vergangenheit wählten vor allem junge, urbane Bürger brieflich – eine Gruppe, die zu den Demokraten tendiert.[1] Bei einem knappen Wahlausgang ist das Szenario denkbar, dass die am Wahlabend ausgezählten Stimmen auf einen Sieg Trumps hindeuten, die in den Folgetagen hinzukommenden aber mehrheitlich an Joe Biden gehen. Vor diesem Hintergrund könnte Trumps Angriff auf die Briefwahl darauf zielen, eine allfällige Aufholjagd seines Kontrahenten als abgekartetes Spiel darzustellen und gegen das Schlussresultat rechtlich vorzugehen – oder gar die Auszählung frühzeitig zu stoppen.
Hohe Akzeptanz in der Schweiz
Vielleicht hilft ein Blick auf die Schweiz, um zu verstehen, warum sich die USA so schwertun mit der brieflichen Stimmabgabe. Hierzulande ist es bei nationalen Abstimmungen und Wahlen seit 1994 voraussetzungslos möglich, seine Stimme auf postalischem Weg abzugeben. Inzwischen ist die briefliche Stimmabgabe zum beliebtesten Stimmkanal geworden. Weit über 80 Prozent der Teilnehmenden bei Wahlen und Abstimmungen geben ihre Stimme brieflich ab.
Allerdings gab es auch in der Schweiz lange Diskussionen über Sinn und Sicherheit der Briefwahl. Nach der Gründung des Bundesstaats 1848 setzte sich zunächst die Wahl an der Urne gegen die Praxis der Wahl- bzw. Abstimmungsversammlungen durch. Nach zwei gescheiterten Versuchen 1936 und 1947 wurde 1967 die briefliche Stimmabgabe erstmals in Ausnahmefällen für Kranke, Gebrechliche und ortsabwesende Personen erlaubt.[2] Mit der Einführung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte 1978 genügte für die briefliche Stimmabgabe ein einfacher Antrag, eine Begründung war nicht mehr nötig. Von da war es kein grosser Schritt mehr zur heutigen Regelung. National- und Ständerat machten 1990 mit der Annahme zweier Motionen den Weg dazu frei.
Die briefliche Stimmabgabe geniesst heute eine hohe Akzeptanz – auch wenn immer wieder Fälle von Manipulationen ans Licht kommen. So flog bei den Wahlen 2017 im Wallis ein SVP-Anhänger auf, der über 100 Wahlkuverts aus Briefkästen gefischt und die Zettel selber ausgefüllt hatte. Grössere Manipulationen dieser Art fliegen aber schnell auf. Potenziell grössere Verschiebungen sind durch Unregelmässigkeiten im Stimmbüro möglich, wie es sie bei den Grossratswahlen im Kanton Thurgau gab. Dieses Problem betrifft dann aber nicht primär den brieflichen Stimmkanal.
Eine Schwäche bei der brieflichen Abstimmung ist, dass das Stimmgeheimnis nicht garantiert werden kann. Es besteht die Möglichkeit, dass Bürger ihren Stimmzettel jemandem zeigen, bevor sie ihn abschicken, oder dass er gar von einer anderen Person ausgefüllt wird. Auch dieses Problem ist allerdings nicht auf diesen Stimmkanal beschränkt, denn auch wer an der Urne abstimmt, füllt seinen Stimmzettel in der Regel zu Hause aus. Hier besteht ein wesentlicher Unterschied zu den USA, wo man seine Stimme traditionell in einer Kabine im Wahllokal abgibt.[3]
Drei Millionen illegale Stimmen?
Was die Sicherheit betrifft, gibt es in den USA keine Hinweise auf grossflächige Manipulationen durch die Briefwahl. Eine Datenbank von News21 listet 491 Fälle von Fälschungen zwischen 2000 und 2012 auf, dies bei mehreren Milliarden abgegebenen Stimmen. Dafür, dass drei Millionen briefliche Stimmen illegal abgegeben werden können, wie dies Trump nach den Wahlen 2016 vermutete, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Tatsächlich dürfte die Zahl der Wahlberechtigten, die an den Hürden zur Stimmabgabe scheitern – insbesondere wenn sie die Dokumente nicht haben, die für den Eintrag ins Wählerregister erforderlich sind –, ungleich höher sein als die Zahl jener, die nur schon versuchen, illegal eine Stimme abzugeben.
Das alles legt nahe, dass der Streit um die Briefwahl in den USA weniger mit der Briefwahl an sich zu tun hat als mit den Wahlen im Allgemeinen. Der Konflikt um den Wahlmodus ist eingebettet in eine grössere Debatte darüber, wer unter welchen Bedingungen wie wählen kann. Keine Demokratie verbringt mehr Zeit mit politischem und juristischem Seilziehen darüber, wie leicht oder schwer der Eintrag ins Wahlregister sein soll, wie die USA. In kaum einem Land betreiben Parteien einen ähnlichen Aufwand, Wahlkreise so zu ziehen, dass das Stimmengewicht der Wähler der jeweils anderen Partei möglichst gering ist. Und kein Land hat eine ähnlich lange und traurige Geschichte von Massnahmen, um Minderheiten von der Ausübung ihrer politischen Rechte abzuhalten. Von teils stümperhafter Organisation, fehlendem Personal, veralteter und unsicherer Infrastruktur ganz zu schweigen.
Ja, die USA steuern auf massive Probleme am 3. November zu. Mit der Briefwahl haben sie aber herzlich wenig zu tun.
[1] Unter Pandemie-Bedingungen könnte sich dieses Muster allerdings ändern: Ältere Wähler könnten stärker geneigt sein, den Gang an die Urne zu vermeiden.
[2] Die Informationen dieses Absatzes stammen aus: Andreas Glaser und Clio Zubler (2020): «Briefliche und elektronische Wahl – Problemfelder des Wahlverfahrens in der Schweiz», in: Andreas Glaser und Lorenz Langer (Hrsg.): Das Parlamentswahlrecht als rechtsstaatliche Grundlage der Demokratie, Zürich/St. Gallen, S. 147-174.
[3] Zumindest theoretisch besteht die Möglichkeit auch in einigen Schweizer Kantonen, wobei sie in der Praxis selten genutzt wird.


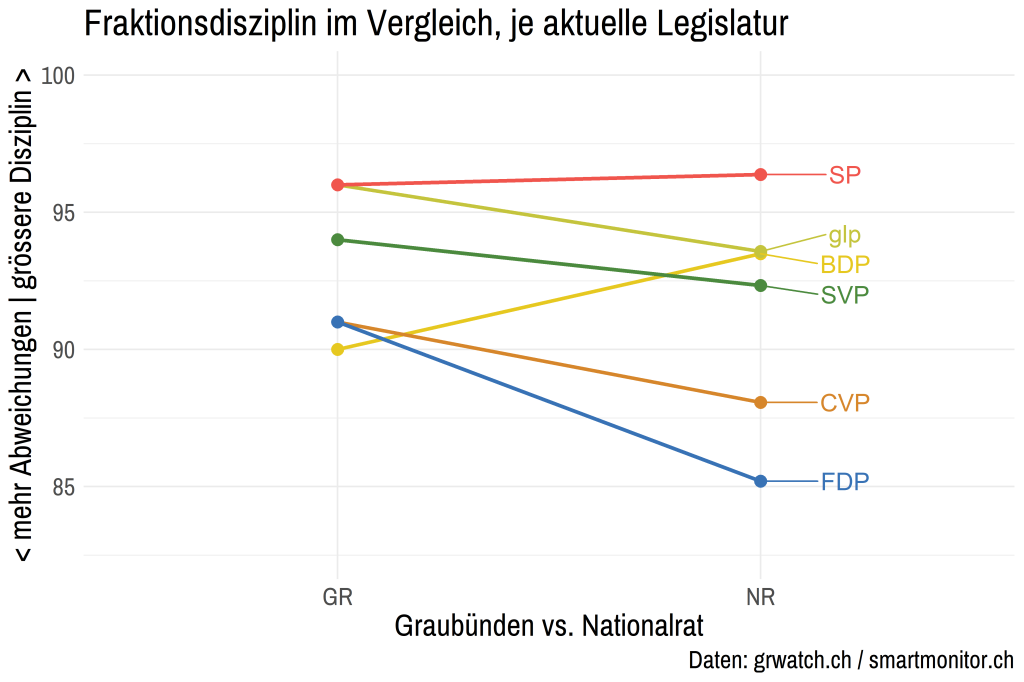
Recent Comments