Die westlichen Demokratien stehen vor einem Paradox: Obwohl die Bürger die Demokratie schätzen, vertrauen sie den Institutionen, die sie wählen, immer weniger. Das hat damit zu tun, dass im Zuge der Globalisierung Anspruch und Wirklichkeit der nationalen Demokratie zunehmend auseinanderklaffen.
Donald Trump hat einen neuen Rekord aufgestellt. Innert acht Tagen nach seinem Amtsantritt ist der Anteil der Amerikaner, die mit seiner Amtsführung zufrieden sind, unter 50 Prozent gefallen. So schnell war das bei keinem seiner Vorgänger der Fall – Barack Obama hatte dafür noch zweieinhalb Jahre gebraucht. Trump kann sich damit trösten, dass er keineswegs der einzige unbeliebte Staatschef ist. In Frankreich sank der Anteil der Bürger, die mit Noch-Präsident François Hollande zufrieden sind, zeitweise auf 4 Prozent.

Die Wähler bescheren Politikern wie François Hollande zwar Wahlsiege, vertrauen ihnen aber wenig. Bild: Parti socialiste (flickr)
Dass Politiker, sobald sie gewählt werden, an Zuspruch verlieren, ist normal. Wer Verantwortung trägt, bietet Angriffsfläche für Kritik. Die Wähler messen einen an den eigenen vollmundigen Wahlversprechen, von denen viele mit der Realität in Konflikt geraten.
Besorgniserregend ist hingegen, dass die Leute sich nicht nur von Politikern enttäuscht abwenden, sondern von den demokratischen Institutionen per se. 1975 gaben in einer Gallup-Umfrage 40 Prozent der Amerikaner an, dem Parlament sehr oder ziemlich stark zu vertrauen. Im Juni 2016 waren es nur noch 9 Prozent. Das Vertrauen in den Präsidenten sank im gleichen Zeitraum von 52 auf 36 Prozent.
In den europäischen Demokratien ist die Entwicklung ähnlich verlaufen. In praktisch allen Ländern stellen Umfragen ein sinkendes Vertrauen in Regierung und Parlament über die Zeit fest – in den etablierten Demokratien Westeuropas ebenso wie in den ehemals sozialistischen Ländern im Osten des Kontinents (wobei der Vertrauensverfall in den südeuropäischen Ländern in den letzten Jahren am stärksten war). Es gibt aber auch Ausnahmen: So blieb in der Schweiz das Vertrauen in Bundesrat und Parlament in den letzten Jahren auf hohem Niveau stabil oder stieg sogar noch.
Das sinkende Vertrauen widerspiegelt sich im über die Jahre ziemlich konstanten Rückgang der Beteiligung an nationalen Wahlen in allen Ländern.
Unbeliebte Politiker, umjubelte Polizisten
Die Enttäuschung über die die demokratischen Institutionen ist nicht gleichzusetzen mit einer grundsätzlichen Ablehnung der Demokratie. Tatsächlich wird die Demokratie nach wie vor fast überall auf der Welt unbestritten als ideale Regierungsform angesehen. Doch die Ansprüche, welche die Bürger an diese Regierungsform stellen, vermögen die Politiker offensichtlich immer weniger zu befriedigen.
Dabei ist es nicht so, dass die Leute generell das Vertrauen in staatliche Institutionen verlieren würden – im Gegenteil: Schaut man sich die Umfragen genauer an, stellt man fest, dass das Vertrauen in die Polizei, in die Armee und auch in die Justiz unverändert hoch sind – jedenfalls höher als in Legislative und Exekutive. Und während letztere in den letzten Jahrzehnten konstant an Zuspruch verloren haben, ist ein ähnlicher Trend bei Militär oder Polizei nicht festzustellen. Sie stiegen sogar eher in der Gunst der Bevölkerung. Es zeigt sich eine wachsende Kluft zwischen demokratisch gewählten und nicht demokratisch legitimierten Institutionen. Die Leute vertrauen jenen Institutionen weniger, die sie selber wählen (wenigstens indirekt) und kontrollieren können, dafür jenen mehr, auf deren Besetzung sie keinen Einfluss haben.
Kritische Bürger
Eine mögliche Erklärung für den Vertrauenszerfall ist, dass Politiker schlicht schlechtere Arbeit leisten. Es wäre allerdings ein ziemlicher Zufall, wenn die Politiker in sämtlichen Demokratien über die Zeit hinweg konstant immer unfähiger, korrupter und volksferner geworden wären.
Umgekehrt ist es auch möglich, dass die politischen Verantwortungsträger zwar nicht schlechtere Arbeit leisten, aber die Erwartungen ihrer Wähler gestiegen sind. Tatsächlich stellten die Politologen Michel Crozier, Samuel Huntington und Joji Watanuki bereits 1975 fest, dass die Ansprüche der Bürger an den Staat gestiegen und überdies vielfältiger geworden seien, so dass Regierungen immer mehr Mühe hätten, diese zu erfüllen.
Die US-amerikanische Professorin Pippa Norris sieht den Vertrauensrückgang daher nicht als etwas Negatives, sondern als Ausdruck einer anspruchsvollen und engagierten Bürgerschaft – von «critical citizens», die sich von ihren Regierungen nicht mehr mit schönen Reden und Versprechen einlullen lassen, sondern den Politikern auf die Finger schauen und sie an die Ansprüche ihrer Wähler erinnern.
Der Spielraum der Nationalstaaten wird kleiner
Dass sich Bürger von den Eliten emanzipiert haben, ist sicherlich richtig. Allerdings vermag dies nicht zu erklären, warum die angeblich engagierte und kritische Bürgerschaft sich immer seltener an Wahlen beteiligt. Ausserdem: Müssten kritische Bürger nicht auch kritischer gegenüber der Polizei oder der Justiz sein? Offenbar steckt mehr hinter dem Vertrauensverlust.
Vielleicht hängt er ja damit zusammen, dass die Erwartungen und die Realität der Demokratie zunehmend auseinanderdriften. Die in den letzten Jahrzehnten stattgefundene zunehmende weltweite Vernetzung – technisch, wirtschaftlich, sozial – hat auch vor der Politik nicht Halt gemacht. Ob Klimaschutz, Handel oder Migration: Immer mehr Herausforderungen betreffen nicht mehr einzelne Staaten, sondern viele oder alle. Gleichzeitig haben Massnahmen einzelner Länder immer mehr Auswirkungen auf andere Länder. Da scheint es nur logisch, dass immer mehr Fragen in inter- und supranationalen Organisationen beraten und entscheiden werden.
Bloss: Jeder Transfer von Entscheidungen hin zu diesen Organisationen hat zur Folge, dass der nationalen Demokratie Kompetenzen entzogen werden. Auf EU-Ebene entscheiden im Wesentlichen der EU-Rat – also die Vertreter nationaler Regierungen – und die EU-Kommission – Gremien, die demokratisch nur sehr schwach legitimiert sind. Derweil haben nationale Parlamente – die eigentlichen Kerninstitutionen der nationalstaatlichen Demokratie – an Einfluss verloren. Die Politik hat sich auf die internationale Ebene verschoben, doch die Demokratie ist ihr nicht gefolgt.
Wenn aber nationale demokratische Institutionen weniger Spielraum haben, wächst auch das Enttäuschungspotenzial für die Wähler. Warum den vollmundigen Wahlversprechen der Politiker noch glauben, wenn am Ende in Hinterzimmern in Brüssel entschieden wird, wie viel Geld nach Griechenland fliesst oder wie viele Flüchtlinge ins Land kommen?
«Der Adressat der Forderungen der Wähler sind nach wie vor die nationalstaatlichen Regierungen», sagt Dieter Fuchs, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Stuttgart. «Doch die Handlungsspielräume dieser Regierungen sind durch die Globalisierung und die Internationalisierung der Politik deutlich kleiner geworden.»
Fehlender Konsens
Hinzu kommt, dass die Politik in den meisten westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten pluralistischer und polarisierter geworden ist. Immer mehr Parteien treten aufs politische Parkett – ein Ausdruck der wachsenden Vielfalt der Gesellschaft und der Unlust der Bürger, sich in einen von zwei oder drei monolithischen Blocken zwängen zu lassen, der ihre Interessen vertreten soll. Die Wähler entscheiden sich nicht mehr aufgrund ihres sozialen oder religiösen Hintergrunds für eine Partei. Stattdessen spielen Werthaltungen eine immer wichtigere Rolle – und zwischen diese lassen sich naturgemäss nur schwer Kompromisse finden. Für Regierungen ist es schwieriger geworden, Resultate zu liefern, die für alle unterschiedlichen Gruppen akzeptabel sind. Demgegenüber besteht bei der Armee, bei der Polizei oder bei Gerichten ein relativ klarer Konsens darüber, was man von ihnen erwartet.
Es scheint also gerade ihr politischer Charakter zu sein, der das Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen weckt. Es ist wohl kein Zufall, dass der oberste Gerichtshof in den USA den Vertrauenszerfall der Legislative und der Exekutive mitgemacht hat – wie in kaum einem anderen Land wird der Supreme Court als politisches Gremium wahrgenommen, in dem sich verschiedene Parteien um die Durchsetzung ihrer Interessen streiten. Dabei wäre die Erwartung an ein Gericht, dass es nach rechtsstaatlichen Grundsätzen urteilt und nicht nach politischen Überlegungen. Ähnlich lässt sich erklären, warum die Europäische Zentralbank (EZB) bei den Europäern weniger Vertrauen geniesst als die nationalen Notenbanken, als diese noch für die Geldpolitik zuständig waren: Die Entscheide des EZB-Rats haben weitreichende politische Auswirkungen, und er wird offenbar als politisches Gremium wahrgenommen.
Das Paradox, das wir jenen am wenigsten vertrauen, die wir wählen können ist also nur auf den ersten Blick ein Paradox: Parlament und Regierung geniessen nicht deshalb weniger Vertrauen, weil sie demokratisch legitimiert sind, sondern weil es politische Gremien sind, die das tun, was Politik im Grunde ausmacht: Sie tragen Konflikte widerstrebender Interessen um Macht und Einfluss aus.
Mehr Demokratie – aber wo?
Müssen wir uns deswegen Sorge um die Demokratie machen? Pessimisten warnen davor, dass sich die Leute mit der Abwendung von demokratischen Institutionen auch von der Demokratie als System abwenden. Darauf deuten die Daten aber wie gesagt nicht hin. Die grundsätzliche Unterstützung für die Demokratie ist in allen westlichen Gesellschaften im Grunde intakt. Auch der vielzitierte Aufstieg der «Populisten» in zahlreichen Ländern ändert daran nichts. Mehr noch: Die Nachfrage nach mehr demokratischer Mitsprache nimmt zu. Forderungen nach Volksabstimmungen als zusätzliches Instrument demokratischer Kontrolle werden ebenso erhoben wie solche nach mehr demokratischem Einfluss auf EU-Ebene.
Die entscheidende Frage ist eine andere: Wie gehen wir mit dem zunehmenden Widerspruch zwischen demokratischen Ansprüchen auf nationaler Ebene und der politischen Realität, die sich immer mehr auf internationaler Ebene abspielt, um? Während einige die Antwort in einem Zurückdrängen internationaler Institutionen und einer Stärkung der nationalstaatlichen Souveränität sehen, befürworten andere eine Demokratisierung der internationalen Politik, etwa eine Stärkung des Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat und der Kommission oder gar EU-weite Volksabstimmungen. Beide Antworten gehen vom Prinzip der Demokratie aus, wonach jene mitreden können, die von einem Entscheid betroffen sind.
Zu bedenken gilt es aber, dass Entscheidungen, die in einzelnen Staaten gefällt werden, fast immer Auswirkungen auf andere Länder haben. Der Beschluss des US-amerikanischen Präsidenten, eine Ölpipeline zu bauen, betrifft das angrenzende Kanada ebenso wie den Rest der Weltbevölkerung, die mit den Folgen eines höheren Ölverbrauchs der Amerikaner auf den Welthandel und ihre Umwelt leben muss. «Die gegenseitigen Abhängigkeiten von Staaten lassen sich kaum aus der Welt schaffen, weil sie überwiegend von Technologie getrieben sind», sagt Michael Zürn, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. «Will man diese Interdependenzen beseitigen, muss man den ganzen technologischen Fortschritt zurückdrängen.»
Solange die Wähler aber weiter die nationalen Regierungen als Hauptverantwortliche sehen – und die Politiker dieses Bild gerne wahren –, wird das Vertrauen in die demokratischen Institutionen so bald nicht zurückkehren.

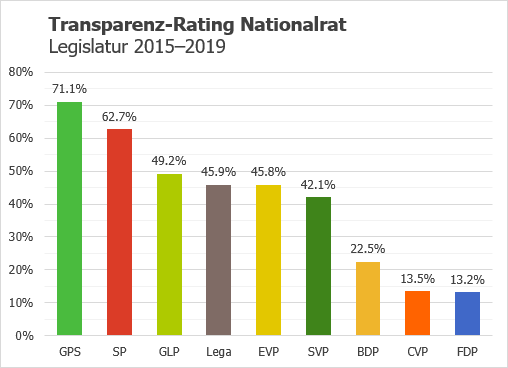






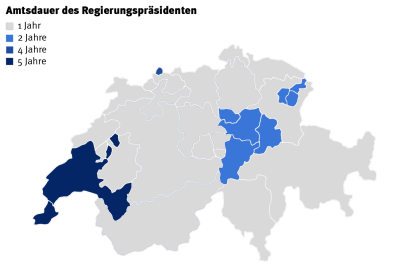
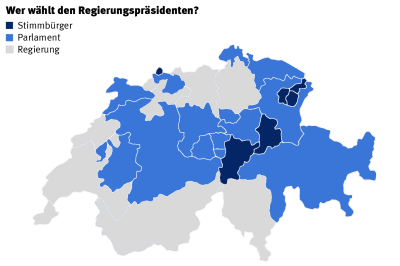


Recent Comments