Claudio Kuster ist unter anderem Stiftungsrat der Stiftung für direkte Demokratie. Er sagt, warum er am kritisierten Ständemehr festhält, dennoch eine Reform befürwortet und wieso es keinen Stadt-Land-Graben in der Schweiz gibt.
Interview: Andrea Tedeschi, publiziert in den «Schaffhauser Nachrichten» vom 5. Dezember 2020.
Die Konzernverantwortungsinitiative ist am Ständemehr gescheitert, obwohl das Volk der Vorlage mit knapper Mehrheit von 50,7 Prozent zugestimmt hat. Wiederholt wurde das Ständemehr aus dem Jahr 1848 deswegen kritisiert und infrage gestellt. Auch nach dem letzten Abstimmungssonntag.

Claudio Kuster.
Herr Kuster, steckt die Schweiz in einer politischen Krise?
Claudio Kuster: Nein, überhaupt nicht.
Das sehen aber Grüne und Jungsozialisten anders. Als das Volk am Sonntag Ja sagte zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI), aber die Kantone Nein sagten, forderten sie Reformen oder eine Abschaffung des Ständemehrs.
Es wäre etwas Einmaliges gewesen, wenn die KVI durchgekommen wäre. Im Kern ging es um das Haftpflichtrecht, es war vor allem eine wirtschaftspolitische Vorlage. Dass eine eher weitgehende Initiative in diesem Bereich angenommen wird, hat es aber noch nie gegeben. Klar wurde die Abzockerinitiative im Jahr 2013 angenommen, aber im Vergleich dazu sind Löhne und Boni ein Nebenthema. Darum verstehe ich die Enttäuschung in gewissen Kreisen, ich bin es auch, und dass der Kontext nun debattiert wird. Das Thema sollte man trotzdem nicht überbewerten.
Sie gehörten selbst zum Schaffhauser Pro-Komitee der KVI. Sind Sie der bessere Verlierer?
In Schaffhausen haben Befürworter wie Gegner für ihre Position hart geworben und gekämpft. Dass das Resultat in Schaffhausen mit 52,8 Nein-Stimmen knapp ausfiel, kann einen nicht überraschen.
Das Resultat zeigt, dass sich die kleinen und eher ländlichen Kantone gegen die lateinische und urbanere Schweiz durchgesetzt haben. Das sorgt für Unmut.
Manchmal überstimmen die urbanen Regionen aber auch die Bergkantone wie zuletzt beim Jagdgesetz oder bei der Zweitwohnungsinitiative. Das sorgte ebenfalls für Verstimmung. Trotzdem würde ich nicht von einem Land-Stadt-Konflikt sprechen. Das halte ich für völlig übertrieben.
Kritiker aber sagen, dass die kleinen Kantone einen zu grossen Einfluss hätten. Haben sie unrecht?
Ja. In der aktuellen Debatte wird oft suggeriert, dass das Stimmgewicht der Appenzell-Innerrhoder 40-mal mehr zähle als jenes der Zürcher. Aber das ist falsch. Die kleinen Kantone können bloss eine Verfassungsänderung verhindern. Eine Mehrheit überstimmen können sie jedoch nicht. Unser Ständemehr wird gerne mit dem US-amerikanischen Wahlsystem verglichen. Im Gegensatz zur Schweiz kann die Minderheit in den USA die Mehrheit tatsächlich verdrängen. Hillary Clinton hat vor vier Jahren mehr Stimmen gemacht als Donald Trump. Aber Trump wurde US-Präsident. Das ist bei uns undenkbar.
Die KVI hat aber ein Volksmehr erreicht. Am Volksmehr scheiterte 2013 auch der Verfassungsartikel über die Familienpolitik. Setzt sich so gesehen nicht doch eine Minderheit durch?
Das stimmt insofern, dass mit dem Ständemehr die kleinen Kantone bevorzugt werden. Traditionell sind viele katholisch und eher konservativ. Aber seit Einführung des Ständemehrs 1848 sind es nur zehn Vorlagen, die ein Ständemehr blockiert hat. Ich behaupte, dass die meisten der Begehren nicht verhindert werden, sondern nur verzögert. Das Ständemehr blockiert Anliegen nicht, es verlangsamt sie bloss. Viele werden später umgesetzt.
Können Sie Beispiele nennen?
Die Vorlage zum Mieter- und Konsumentenschutz scheiterte 1955, kam aber bereits fünf Jahre später wieder an die Urne und diesmal durch. Kürzlich bekam die Schweiz ein neues Bürgerrechtsgesetz, das die Einbürgerung liberalisiert und vereinfacht hat. In Schaffhausen will man sogar den Bürgerrat abschaffen. Noch in den Neunzigern scheiterte eine Vorlage zur einfacheren Einbürgerung am Ständemehr. Und bei der KVI tritt immerhin der indirekte Gegenvorschlag in Kraft, international wird die Haftungsfrage ebenfalls gross diskutiert. Das Thema wird virulent bleiben. Dennoch muss man differenzieren.
Inwiefern?
Acht der zehn vom Ständemehr abgelehnten Vorlagen waren obligatorische Referenden. Die Mehrheit des Bundesrates, Ständerates und Nationalrates haben sich für sie ausgesprochen. Scheitert eine Vorlage, versuchen diese Kräfte bald, ihre Begehren über andere Wege wie Gesetzes- oder Verfassungsrevisionen durchzusetzen. Bei Volksinitiativen ist das viel schwieriger, es ist auch ein Riesenaufwand, da muss ich den Kritikern des Ständemehrs recht geben. Zum einen dauert es fünf bis sieben Jahre, bis eine Volksinitiative an die Urne kommt. Andererseits ist es in diesen Fällen viel schwieriger, das Thema nochmals aufzugreifen, weil im Parlament und im Bundesrat die befürwortenden Mehrheiten fehlen. In der Geschichte der Schweiz ist das aber immerhin nur zweimal vorgekommen.
Beim Jagdgesetz konnten die Umweltorganisationen ihre Mitglieder gegen das Jagdgesetz mobilisieren. Bei der KVI engagierten sich breite Kreise der Zivilgesellschaft dagegen. Hat das künftig Auswirkungen auf die Begehren?
Dass sich Bürger in Umweltfragen engagieren, ist nichts Neues. Grüne Kreise mobilisieren hier seit den 1980ern, denken Sie an die Anti-Atomkraft-Bewegung oder das Ja zur Moorschutz-Initiative. In den Neunzigern folgte die Alpenschutzinitiative und in den Nullerjahren die Gentech-Initiative. Mehrheitsfähig waren sie deshalb, weil die Natur zu bewahren letztlich ein konservatives und nicht per se progressives oder linkes Anliegen ist.
Aber muss die Schweiz künftig mehr mit Vorlagen wie der KVI rechnen?
Nein, ganz klar nicht. 130 Nicht-Regierungsorganisationen, Investoren, Frauenverbände und die Landeskirchen hinter eine Initiative zu scharen ist einmalig. Das schafft man alle zehn oder zwanzig Jahre. Zumal eine solch langfristige und professionelle Kampagne den Mitgliedern viel Zeit und Finanzen abverlangt. Dann muss es aber auch noch das richtige Thema zur richtigen Zeit sein.
Dennoch hat ein Ständemehr das Volksmehr in den letzten 50 Jahren überdurchschnittlich blockiert. Worauf führen Sie das zurück?
Es gab einfach mehr Abstimmungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen zum einen neue Themen in der Aussenpolitik oder Ökologie dazu. Auch hat man immer mehr Kompetenzen von den Kantonen an den Bund übertragen. Das hat jedes Mal eine Verfassungsänderung mit sich gebracht.
Also gibt es nicht unbedingt mehr Konflikte im Land?
Im Gegenteil. Die ursprünglichen Konflikte zwischen den konservativen und liberalen Kantonen haben seit dem Sonderbundkrieg stark abgenommen. Früher befürworteten oder verwarfen einzelne Kantone Vorlagen regelmässig mit 80 oder 90 Prozent. Heute liegt das Verhältnis eher bei 60 zu 40. Selbst wenn Kantone an der Urne verlieren, unterliegen sie nie ganz.
Sie halten also am aktuellen Ständemehr fest?
Ja. Den Leuten ist oft nicht bewusst, dass die Schweiz aus 26 «Staaten» besteht. Jetzt mit Corona wird das sichtbar, wenn etwa die Kantone Basel, Genf, Waadt oder seit gestern Graubünden einen harten Lockdown beschliessen. In einem Zentralstaat wie Frankreich wäre es undenkbar, solch weitgehende Massnahmen lokal in der Bretagne oder im Elsass zu erlassen. Gäbe es das Ständemehr nicht, könnten die fünf grössten Kantone den anderen 21 eine Verfassung aufzwingen, also Aargau, Bern, St. Gallen, Zürich und Waadt. Das geht nicht!
Dennoch schlagen Sie eine Reform mit der «stetigen Standesstimme» vor. Warum?
Weil es den Minderheiten in den Minderheiten entgegenkommt. Grüne Politikerinnen im Kanton Appenzell Innerrhoden oder rechtskonservative Jurassier werden heute ignoriert. Es gilt das Winner-takes-it-all-Prinzip. Bei 52,8 Nein-Stimmen in Schaffhausen wird die Standesstimme direkt auf null gesetzt. Ich plädiere deshalb dafür, dass die Standesstimme proportional zum Verhältnis der Ja- und Nein-Stimmen aufgeteilt wird. Dann hätte Schaffhausen bei der KVI eine Standesstimme 0,47. So würden auch die Befürworter im Kanton berücksichtigt, die Parität der Kantone aber gewährt. Jeder Kanton behielte seine Stimme.
Wäre die KVI oder der Familienartikel 2013 mit der «stetigen Standesstimme» durchgekommen?
Nein. Die KVI wäre knapp gescheitert, weil die Befürworter-Kantone zu wenig klar Ja gesagt haben, die ablehnenden Kantone aber zu stark Nein. Der Familienartikel dagegen wäre durchgekommen, weil die Kantone Genf, Waadt und Jura mit 70 bis 80 Prozent der Vorlage stark zugestimmt hatten.
So eine Reform ist faktisch chancenlos. Kleine Kantone geben ihre gewichtige Stimme nicht ab. Und eine Reform braucht ihrerseits ein Ständemehr.
Bei der ganzen Debatte geht vergessen, dass das Ständemehr nur ein Element des Föderalismus ist. Es gibt die Standesinitiative, das Kantonsreferendum, die Konferenzen und Konkordate und vor allem den Ständerat. Die Romands gegen die Deutschschweizer oder die Bergler gegen die Städter, das ist nicht so problematisch. Es sind die klassischen Konfliktlinien, auf die wir eher achten sollten und die den Konsens strapazieren: die Linken gegen die Rechten und die Liberalen gegen die Konservativen.







 Wolf Linder
Wolf Linder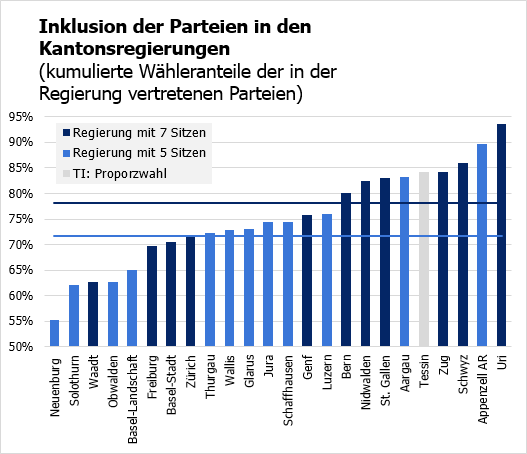

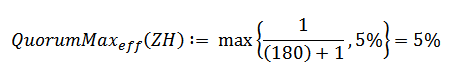

Recent Comments