Wen repräsentiert eigentlich Christoph Blocher (SVP/ZH)? Die Verteilung der Nationalratssitze betrachtend, nicht nur Schweizer Mannen und Frauen.
Gewählt wurde Nationalrat Christoph Blocher (SVP/ZH) bei den letzten Nationalratswahlen mit 139’120 Stimmen, die von Zürcher Stimmberechtigten, also Schweizerinnen und Schweizern rührten. Da er nach dem Proporzwahlverfahren ins Parlament gehievt wurde, braucht er grundsätzlich auch nur für seine Wählerinnen und Sympathisanten der Schweizerischen Volkspartei zur politisieren.
Tritt jedoch die Frage hinzu, wieso er eigentlich einer von just 34 (zukünftig: 35) Zürcher Parlamentarier ist, könnte man auch zu einem anderen Schluss gelangen. Denn die Zuteilung der 200 Nationalratssitze auf die 26 Wahlkreise geschieht nicht anhand der Anzahl Stimmberechtiger der jeweiligen Kantone. Die Verfassung sieht nämlich vor, die Nationalratssitze «nach der Bevölkerungszahl auf die Kantone» zu verteilen. Als sogenannte Repräsentationsbasis fungieren also nicht nur die Eidgenossen, sondern die ständige Bevölkerung, wodurch Elektorat und Repräsentierte divergieren. Nationalrat Blocher – wie auch seine 33 Zürcher Kolleginnen und Kollegen – repräsentiert zwar politisch hauptsächlich Schweizer Mannen und Mütter. Zuteilungs-mathematisch vertreten die Parlamentarier aber gleichwohl niedergelassene Ausländer und Kinder. Kurzaufenthalterinnen und Diplomaten. Asylsuchende und aufgenommene Flüchtlinge. (Nicht jedoch Auslandschweizer, obschon diese ebenso zur aktiven wie passiven Wahl zugelassen sind.)
Diese breite Berechnungsbasis für das Sitzzuteilungsverfahren wird seit der Gründung des Bundesstaats 1848 angewandt, wenn auch damals noch «Seelen der Gesammtbevölkerung» in den «Nationalrath» entsandt wurden. Den untergeordneten Staatsebenen schreibt die Bundesverfassung jedoch nicht zwingend dasselbe Verfahren vor. Daher finden sich in den Kantonen drei weitere Repräsentationsbasen wieder, auf welchen die Distriktzuteilung zur Bestellung der kantonalen Parlamente fusst. Weiter sind derzeit mehrere Vorstösse hängig, welche ebenfalls Änderungen an der massgeblichen Bevölkerung anstreben:
Modell «Ständige Wohnbevölkerung»:
21 Kantone[1] wenden die gleiche Repräsentationsbasis an wie der Bund, indem sie nebst den Schweizer Bürgern alle Personen mitzählen, welche sich seit wenigstens 12 Monaten in der Schweiz befinden. Dazu zählen mitunter Personen, welche sich seit über einem Jahr im Asylprozess befinden, wie auch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Weiter gesellen sich Diplomaten und internationale Funktionäre hinzu. Nicht berücksichtigt wird hier die «nichtständige Wohnbevölkerung», hauptsächlich Kurzaufenhalter (Bewilligung L).
Modell «Zivilrechtliche Bevölkerung»:
Im Kanton Freiburg wird praktisch die gleiche Repräsentation wie die «ständige Wohnbevölkerung» verwendet. Nicht berücksichtigt werden hier lediglich die Diplomaten, was jedoch praktisch kaum zu Änderungen an der Sitzzuteilung führt.
Modell «Schweizer Bürger sowie ausländische Personen mit Ausweis C oder B»:
Kürzlich hat die SVP-Bundeshausfraktion eine Motion in den Nationalrat getragen, welche einen Kompromiss in der Berücksichtigung der Repräsentation der ausländischen Bevölkerung sucht: Das Verfahren integriert im Vergleich zu den obigen Modellen zwar ebenso die ausländische Wohnbevölkerung, wenngleich nur jene, welche sich zumindest mittelfristig hierzulande niederlässt. Nebst den Diplomanten werden hier vornehmlich die Personen im Asylprozess (F und N) nicht miteinbezogen. Da letztere proportional auf die Kantone verteilt werden, ergäben sich auch hierbei nur kleinere Änderungen bei der Sitzverteilung. Dieses Modell wird derzeit in keinem Kanton angewandt.
Modell «Schweizer Wohnbevölkerung»:
In den drei Kantonen Graubünden, Uri und Wallis wird auf die Nationalität Schweiz abgestellt. Gleiches will eine hängige Berner Motion für die Wahlkreiszuteilung für die Grossratswahlen installieren. Im Berner Grossrat wie im Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden wiederum sind analoge Motionen auf Standesinitiative hängig, welche dieses Modell für die Nationalrats-Sitzzuteilung vorsehen möchten.
Modell «Schweizer Stimmberechtigte»:
Im Kanton Basel-Landschaft schliesslich findet sich die engste, wenn auch kongruente Repräsentation wieder, da hier nur die Wählerschaft selbst massgeblich ist für die Sitzzuteilung in die Wahlkreise. In Baselland werden – nebst der ausländischen Bevölkerung – also auch weder Kinder noch Entmündigte durch die Landräte vertreten. Nachdem man in Solothurn erfuhr, dass der Kanton 2015 nur noch 6 Nationalräte stellen wird, wurde auch dort flugs ein Antrag für eine Standesinitiative eingereicht, die dieses Modell für die nationalen Wahlen einführen soll.
Wie gezeigt, streben drei unterschiedliche Vorstösse eine Änderung der Repräsentationsbasis zum Sitzzuteilungsverfahren des Nationalrats an. Die Diskussion über die verschiedenen Modelle ist keineswegs eine rein theoretische Angelegenheit, sondern hat durchaus grosse praktische Relevanz. Dies zeigt folgende Übersicht, welche das aktuelle Verfahren mit den drei vorgeschlagenen Methoden und deren hypothetischen Sitzverteilungen vergleicht:
Repräsenta-tionsbasis
(alle Zahlen von 2011, BFS STAT-TAB) |
Ständige Wohn- bevölkerung
(= aktuelles Verfahren) |
Schweizer plus Ausländer mit Ausweis B/C
(= Motion SVP-Fraktion) |
nur Schweizer Bevölkerung
(= Verfahren GR/UR/VS; Vorstösse BE/AR) |
nur Schweizer Stimm-
berechtigte
(= Verfahren BL; Vorstoss SO) |
| Zürich |
35 |
35 |
34 (-1) |
34 (-1) |
| Bern |
25 |
25 |
28 (+3) |
28 (+3) |
| Waadt |
18 |
18 |
16 (-2) |
16 (-2) |
| Aargau |
15 |
16 (+1) |
16 (+1) |
16 (+1) |
| Genf |
12 |
11 (-1) |
9 (-3) |
9 (-3) |
| St. Gallen |
12 |
12 |
12 |
12 |
| Luzern |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Tessin |
8 |
8 |
8 |
8 |
| Wallis |
8 |
8 |
8 |
8 |
| Basel-Landschaft |
7 |
7 |
7 |
7 |
| Freiburg |
7 |
7 |
8 (+1) |
7 |
| Solothurn |
6 |
6 |
7 (+1) |
7 (+1) |
| Thurgau |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Basel-Stadt |
5 |
5 |
4 (-1) |
5 |
| Graubünden |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Neuenburg |
4 |
4 |
4 |
4 |
| Schwyz |
4 |
4 |
4 |
4 |
| Zug |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Jura |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Schaffhausen |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Appenzell A.Rh. |
1 |
1 |
2 (+1) |
2 (+1) |
| Appenzell I.Rh. |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Glarus |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Nidwalden |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Obwalden |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Uri |
1 |
1 |
1 |
1 |
Die Ursache für die erwarteten Sitzwanderungen liegt auf der Hand: Die Kantone, welche Federn lassen müssten, haben überdurchschnittliche Ausländeranteile. Die Geberkantone Genf (39 %), Basel-Stadt (33 %) und Waadt (32 %) haben denn auch die höchsten Anteile, während bei Zürich (25 %) zusätzlich die hohe absolute Anzahl Nationalratssitze mitspielt. In der UNO-Stadt Genf haben zusätzlich die über 22’000 Diplomaten einen bedeutsamen Einfluss: Alleine aufgrund ihrer Präsenz darf Genf heute einen zusätzlichen Nationalrat stellen (zulasten Aargau).
Umgekehrt profitieren tendenziell Kantone mit unterdurchschnittlichen (< 23 %) Anteilen ausländischer Bevölkerung, allen voran Bern (14 %), der hier als zweitgrösster Kanton sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen kann. Die etwaigen Sitzgewinne für Aargau, Freiburg und Solothurn (Ausländeranteile 19–22 %) müssen jedoch als eher zufällig bezeichnet werden, spielen hier doch auch andere Effekte hinein, namentlich ihre vorteilhaften Bevölkerungsentwicklungen.
Schlussendlich soll jedoch unabhängig von den drei eigennützig motivierten Anträgen auf Standesinitiative (AR, BE und SO wären allesamt Sitzgewinner – komplettierende Vorstösse aus AG und FR lassen noch auf sich warten) überdacht werden, welche Repräsentationsbasis die legitimste ist: Ein gänzlicher Ausschluss der ausländischen Bevölkerung, wie es die zwei letzteren Modelle vorsehen, erscheint nicht opportun. Denn die Legislative fällt durchwegs Entscheide, welche für die komplette hiesige Bevölkerung relevant sind; unsere Paragraphen und Steuerfüsse gelten ebenso für die 23 Prozent Nicht-Schweizer.
Opportune Berücksichtigung der gesamten Bevölkerung
Da sie schon nicht mitbestimmen können, soll wenigstens die Anzahl Volksvertreter auch von den Ausländerinnen und Ausländern abhängig gemacht werden. Der Einbruch in die Erfolgswertgleichheit der Wählenden (Genfer Wähler haben heute grob 50 % mehr Wahlkraft als die Urner – weil sie gewissermassen auch für die 39 % Ausländer in Genf «mitbestimmen» können) ist dabei aufgrund des übergeordneten, öffentlichen Interesses hinzunehmen.
Inkonsequent sind darüber hinaus die Befürworter der Basis «Schweizer Bevölkerung» (Vorstösse AR und BE), da sie mit der vermeintlichen Kongruenz zwischen den Bürgern mit aktivem und passivem Wahlrecht einerseits und der Repräsentationsbasis andererseits argumentieren. Doch werden hier just die zahlreichen Minderjährigen gefliessentlich unter den Tisch gekehrt: Stimmberechtigte und Schweizer sind zwei paar Schuhe.
Ganz generell ist von einem Nationalrat (und ebenso übrigens von einem Ständerat) zu erwarten, dass er sich nicht nur für seine «eigenen» Wähler einsetzt, sondern für das übergeordnete Landesinteresse. Entsprechend erscheint es durchaus vernünftig, dass die gesamte Bevölkerung des Landes für die Verteilung der Nationalratssitze massgebend ist. Hier soll jedoch gleichwohl auf eine Bevölkerungsbasis abgestellt werden, welche hierzulande nicht nur kurzfristig, sondern mittel- bis langfristige Wurzeln schlägt, wie es die Motion der SVP-Bundeshausfraktion vorschlägt. Ob deswegen jedoch gleich die dazu nötige Teilrevision der Bundesverfassung in Angriff genommen werden soll, ist ob der erwarteten geringen Wirkung (eine einzige Sitzverschiebung) die andere Frage.
Ergänzung (01.09.2013):
Im Verlauf dieser Woche wurden im Kontext der Sitzzuteilung an die Nationalrats-Wahlkreise folgende weitere Artikel bzw. Erlasse publiziert:
[1] Die Kantone AG, AI, AR, BE, BS, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH.


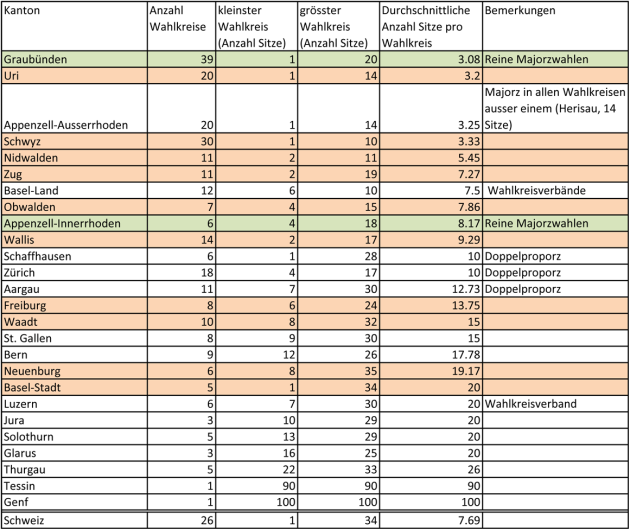


Recent Comments