In mehreren Kantonen wird derzeit über Änderungen beim Wahlrecht diskutiert. Die Argumente sind dabei nicht neu – es sind weitgehend die gleichen wie vor hundert Jahren.

Keine «Anarchisten und Antimilitaristen» im Parlament: So warben die Proporzgegner 1910 für ein Nein. Bild: Europeana
Das neue System sei «künstlich», «kompliziert» und «dem Volke unverständlich». Es würde zu einer «zersplitterten Vertretung» im Parlament führen, das damit zu einer «Versammlung von Minderheiten» degenerieren würde.[1] Diese Worte äusserte der Bundesrat im Jahr 1910 in seiner Botschaft zur Volksinitiative «für die Proporzwahl des Nationalrates». Es war die zweite von insgesamt drei Volksbegehren zur Einführung der Verhältniswahl. Das dritte wurde schliesslich 1918 vom Volk angenommen. Die Argumente des Bundesrats und der freisinningen Mehrheit im Parlament waren bei allen drei Initiativen in etwa die gleichen.
Gut hundert Jahre später verwendet der Bundesrat ganz ähnliche Argumente. Das vorgeschlagene System sei «reichlich komplex und aufwändig» in der Ermittlung der Resultate, schreibt er 2003 in einer Stellungnahme. Dies gehe zulasten der Transparenz, die er als «eine unabdingbare Voraussetzung für ein breites Vertrauen in alle demokratischen Entscheidungen» ansieht.[2]
Diesmal geht es nicht um den Wechsel zum Proporzsystem, sondern um das doppeltproportionale Zuteilungsverfahren, über dessen Einführung derzeit in vielen Kantonen diskutiert wird.
Vergangenen Herbst haben die Stimmbürger in Nidwalden und Zug dem Wechsel zum doppeltproportionalen Verfahren (nach seinem Erfinder auch doppelter Pukelsheim genannt) zugestimmt, das eine proportionalere Verteilung der Sitze auf die Parteien ermöglicht. Das Verfahren, das zuvor auch Zürich, Aargau und Schaffhausen eingeführt hatten, steht in mehreren weiteren Kantonen zur Debatte, so etwa in Schwyz, Obwalden, Freiburg und Uri. Dabei stösst bzw. stiess es vielfach auf erbitterten Widerstand unter den etablierten Grossparteien.
Auffallend ist, dass die Argumente, die heute gegen Wahlrechtsreformen wie die Einführung des doppelten Pukelsheims ins Feld geführt werden, erstaunliche Ähnlichkeiten zur Proporzdiskussion anfangs des 20. Jahrhunderts aufweisen. Die Furcht vor einem Parlament als «Versammlung von Minderheiten» bekräftigte die herrschende FDP, die 1909 in einer Resolution vor der «Zersplitterung» des Parlaments warnte und für «eine Politik der Konzentration aller guten Kräfte» eintrat.
Nicht viel anders tönt es 2013 in einem vom Bundesrat verabschiedeten Bericht zur Wahlrechtsdiskussion (der auch in diesem Blog gewürdigt wurde). Darin gibt die Regierung Bedenken Ausdruck, der Doppelproporz könne «einer Parteienfragmentierung Vorschub leisten». In die gleiche Richtung geht das Votum des Nidwaldner Landrats Toni Niederberger (SVP), der bei der Diskussion im Nidwaldner Kantonsrat über das neue Wahlsystem 2012 sagt: «Heute geht der Trend zum Minderheitenschutz ohne Ende. Alle Minderheiten werden geschützt. Aber am Schluss kommt die Mehrheit zu kurz.» Und in Zug warnt Kantonsrat Heini Schmid (CVP) davor, «dass am Ende der Kantonsrat sich nur noch aus einem Sammelsurium von Piraten, Freibeutern und anderen Splittergruppen zusammensetzt».
Hundert Jahre zuvor waren die Minderheiten, die man fürchtete, noch andere. In einem vom Bundesrat in Auftrag gegebenen Gutachten warnte der Staatsrechtler Carl Hilty 1883, das Proporzsystem werde «Ultramontanen, Sozialisten und Nihilisten zu Sitz und Stimme» verhelfen.
Der Bundesrat sah sogar das Funktionieren des Parlaments in Gefahr. In der Botschaft von 1910 schrieb er, es sei «ein unentbehrliches Erfordernis des parlamentarischen Lebens und jeder Regierung», dass aus den Wahlen jeweils eine parlamentarische Mehrheit hervorgehe. Ansonsten herrsche «nur noch Verwirrung und Anarchie».[3]
In die gleiche Richtung gehen die Befürchtungen des Präsidenten der Freiburger FDP, Didier Castella, «der Anteil von vielen, bei jeden Wahlen wechselnden Kleinstparteien» vermindere die «Effizienz» des Parlamentsbetriebs.
Ein weiteres beliebtes Argument der etablierten Parteien ist, dass sich das bisherige System bewährt habe. In seiner Botschaft zur Proporzinitiative fragte der Bundesrat 1910 rhetorisch, ob «in unserer Demokratie so schwere Mängel zutage getreten» seien, die eine Änderung des Wahlsystems erforderten: «Hat nicht der gegenwärtige Modus dazu beigetragen, den regelmässigen Gang unserer Institutionen sicherzustellen?»
Ein Jahrhundert später betont der Zuger Kantonsrat Eugen Meienberg (CVP), das Wahlsystem habe sich «über hundert Jahre bewährt» und man sollte es daher «nicht einfach aufgeben». Ähnlich tönt es etwa bei der FDP Obwalden, die kein Verständnis dafür hat, dass das «bewährte» System «plötzlich umgekrempelt» werden soll.
Das Argument lässt sich natürlich auch dahingehend umkehren, dass sich das vorgeschlagene System, dort wo es ausprobiert wurde, nicht bewährt habe. So mahnte die rechtsfreisinnige Gruppe Philibert Berthelier in einer Resolution, der Proporz habe im Kanton Genf «den Ultramontanismus gefördert». Und im Nationalrat zog der Genfer Henri Fazy im Bezug auf Genf das Fazit einer «expérience déstastreuse».
Ebenso düster fällt das Fazit zum doppelten Pukelsheim aus – zumindest in den Augen des Schwyzer Kantonsrats Peter Häusermann (SVP). Im Kanton Zürich habe der doppelte Pukelsheim ein «grosses Durcheinander» ausgelöst und zu «verseuchten Wahlen» geführt, weiss er 2012 im Parlament zu berichten.
Die Liste von Argumenten, die heute ebenso wie schon vor hundert Jahren gegen die Änderung des Wahlrechts ins Feld geführt werden, liesse sich beliebig verlängern. Sogar die Seitenhiebe gegen die Nationalität politischer Gegner («ein oberschlauer, gescheiter Professor aus Deutschland») sind kein Novum. So versuchte Carl Hilty seinen Gegengutachter François Wille zu desavouieren, indem er ihn hämisch als «eingewanderten Deutschen» bezeichnete.
Allerdings gibt es auch Unterschiede in den Argumentationen. Beispielsweise verhehlten die Politiker während der Proporzdiskussion kaum, dass es ihnen im Grunde vor allem um die eigenen Machtgewinne bzw. -verluste ging. Hilty, der inzwischen für die FDP in den Nationalrat gewählt worden war, gab während der Debatte 1900 freimütig zu, bei der Wahlrechtsdiskussion gehe es «nicht um eine Gerechtigkeitsfrage, auch nicht um eine wissenschaftliche Frage, sondern um eine Machtfrage».
Auch der freisinnig dominierte Bundesrat machte kein Geheimnis aus den eigenen Machtinteressen, als er sich 1910 dagegen aussprach, ein Wahlsystem einzuführen, das «zu einer Gefährdung des Bestehens und des Einflusses der grossen Parteien oder sogar zu ihrer Zerstörung führen» könnte.
Derart offensichtlich macht sich heute wohl niemand mehr für die eigenen Interessen stark, wenn es um Wahlrechtsfragen geht. Daraus zu folgern, dass solche Interessen keine Rolle mehr spielen, dürfte allerdings eher Wunschdenken sein. Das zeigt sich allein daran, dass jene Parteien, denen eine Reform des Wahlsystems mehr Sitze bringen würde, meistens die gleichen sind, welche die Änderung befürworten, während die Gegner in der Regel jene sind, die am meisten zu verlieren haben. Vielmehr scheint es, dass die Politiker in den vergangenen hundert Jahren beim Politmarketing dazugelernt haben.
[1] Sämtliche historischen Zitate sind Natsch, Rudolf (1972): «Die Einführung das Proporzwahlrechts für die Wahl des schweizerischen Nationalrats (1900-1919)», in: La démocratie référendaire en Suisse au XXe siècle, S. 119-192, sowie Kölz, Alfred (1992): Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte entnommen.
[2] Freilich hat die Begeisterung des Bundesrats für Transparenz auch Grenzen.
[3] Das Argument aus der Feder des Bundesrats entbehrt nicht einer gewissen Ironie, hatte doch der Bundesrat selbst 1891 dem Tessin das Proporzsystem aufgezwungen, um den eskalierenden Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen zu beenden (was auch gelang).






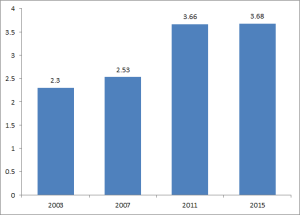



Recent Comments