Mehrere Kantone haben in den vergangenen Jahren auf Anweisung des Bundesgerichts ihr Wahlsystem geändert und den Doppelproporz eingeführt. Dagegen gibt es in Bundesbern Widerstand. Doch was hat sich mit dem neuen Verfahren eigentlich geändert? Eine Analyse gibt Aufschluss.
Der vorliegende Beitrag wurde im Dezember 2018 in der Zeitschrift «Parlament/Parlement/Parlamento» (Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen), publiziert. Eine Zusammenfassung der Analyse erschien am 11. September 2018 in der «Neuen Zürcher Zeitung».
1. Einleitung
In den vergangenen Jahren haben sieben Kantone ihr Wahlsystem geändert und das so genannte doppeltproportionale Divisorverfahren mit Standardrundung (kurz: Doppelproporz) eingeführt.[1] In den meisten Fällen kam der Anstoss dazu vom Bundesgericht, welches die zuvor angewandten Wahlsysteme als im Widerspruch zur Wahlrechtsgleichheit und damit zur Bundesverfassung taxiert hatte. Gegen die Praxis des Bundesgerichts hat sich Widerstand formiert. Die Kantone Zug und Uri[2] reichten Standesinitiativen ein und forderten, dass die Kantone mehr Spielraum erhalten sollen bei der Ausgestaltung ihres Wahlsystems. National- und Ständerat nahmen die Standesinitiativen an; die Staatspolitische Kommission des Ständerats arbeitete daraufhin eine Vorlage zur Änderung der Bundesverfassung aus. Gemäss dieser soll die Verfassung explizit festhalten, dass die Kantone «frei in der Ausgestaltung der Verfahren zur Wahl ihrer Behörden» sind.[3] Der Ständerat stimmte der Vorlage in der Frühjahrssession 2018 zu. Der Nationalrat folgte ihm in der Wintersession zunächst, hat die Verfassungsänderung dann allerdings in der Schlussabstimmung abgelehnt.[4]
Angesichts der teilweise hitzigen Debatte erstaunt, dass bisher nicht systematisch untersucht wurde, welche Auswirkungen der Doppelproporz in der Praxis eigentlich hat. Diese Lücke will der vorliegende Beitrag schliessen. Er vergleicht die Wahlergebnisse aller sieben Kantone, die das Verfahren eingeführt haben, mit der hypothetischen Sitzverteilung nach dem früheren Wahlsystem. Zudem werden die tatsächlichen Veränderungen bei der ersten Anwendung des Systems betrachtet hinsichtlich der Zahl der Listen und der Wahlbeteiligung.
2. Hintergrund
2.1. Die Praxis des Bundesgerichts
Bei der Beurteilung kantonaler Wahlsysteme stützt sich das Bundesgericht auf die Wahlrechtsgleichheit. Diese ergibt sich aus der Garantie der politischen Rechte (Art. 34 BV), welche die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe schützt, teilweise wird auch auf die Rechtsgleichheit (Art. 8) zurückgegriffen. Die Wahlrechtsgleichheit setzt sich gemäss klassischer Auffassung aus drei Komponenten zusammen: Die Zählwertgleichheit garantiert, dass alle Wähler gleich viele Stimmen haben («one man, one vote»); die Stimmkraftgleichheit stellt sicher, dass jede Stimme möglichst das gleiche Gewicht hat, dass also das Verhältnis der repräsentierten Bevölkerung zur Anzahl Sitze in allen Wahlkreisen möglichst gleich sein soll; die Erfolgswertgleichheit schliesslich sieht vor, dass jeder Wähler in der Praxis den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis hat.[5] Diese Bedingung ist verletzt, wenn Wähler kleinerer Parteien faktisch keine Chance haben, im Parlament vertreten zu sein, was namentlich bei kleinen Wahlkreisen der Fall ist. Massgebend ist dabei das natürliche Quorum, also der Stimmenanteil, den eine Partei mindestens erreichen muss, um im Parlament vertreten zu sein. In einem Wahlkreis mit 9 Sitzen beträgt das natürliche Quorum 10 Prozent. Diesen Wert erachtet das Bundesgericht bei Proporzsystemen als Maximum. Liegt das Quorum in einem Wahlkreis darüber, sieht das Gericht die Erfolgswertgleichheit verletzt und das Wahlsystem muss angepasst werden, um den Anforderungen der Bundesverfassung zu genügen.[6]
Dazu gibt es verschiedene Wege. Ein offensichtlicher ist, kleine Wahlkreise zu grösseren zusammenzulegen, die mehr Sitze und damit ein tieferes natürliches Quorum aufweisen.[7] Eine andere Möglichkeit sind Wahlkreisverbände, bei denen mehrere Wahlkreise für die Sitzzuteilung zusammengefasst werden.[8] Die Kantone, die in der jüngeren Vergangenheit zu einer Änderung ihres Wahlsystems verpflichtet wurden, haben sich jedoch alle für einen dritten Weg entschieden: den Doppelproporz. Bei diesem werden die Sitze über den ganzen Kanton hinweg auf die Parteien verteilt, sodass die gesamtkantonale Sitzverteilung die gesamtkantonalen Stimmenanteile möglichst genau abbilden; gleichzeitig werden die Sitze in den einzelnen Wahlkreisen möglichst proportional verteilt.
In Bezug auf Majorzwahlsysteme bei kantonalen Parlamentswahlen hat sich das Bundesgericht bislang zurückhaltend geäussert, obschon die Erfolgswertgleichheit (und teilweise auch die Stimmkraftgleichheit) dort stark eingeschränkt sind. In einem Urteil zum Kanton Appenzell Ausserrhoden[9] haben die Richter in Lausanne die Anwendung des Majorzsystems als zulässig erachtet, allerdings nur unter gewissen Umständen (etwa eine schwache Stellung der Parteien und die Autonomie der als Wahlkreise fungierenden Gebietskörperschaften). Eine Beschwerde aus dem Kanton Graubünden ist derzeit beim Bundesgericht hängig.
2.2. Die Kantone mit Doppelproporz-System
Bisher haben sieben Kantone den Doppelproporz eingeführt.[10] Bei den konkreten Umständen und der Umsetzung gibt es allerdings bedeutende Unterschiede. Die Kantone Aargau, Nidwalden, Schwyz, Zug und Wallis führten das System als Folge von Urteilen des Bundesgerichts ein. Zürich und Schaffhausen gingen diesen Schritt von sich aus (wenn auch im Wissen, dass das alte Wahlsystem vor Bundesgericht keinen Bestand haben würde).[11] Als erster Kanton wechselte Zürich 2007 zum Doppelproporz, und zwar als Reaktion auf ein Bundesgerichtsurteil zur Stadt Zürich fünf Jahre zuvor. Der bisher letzte Kanton, der nach dem doppeltproportionalen System wählte, war Wallis im Jahr 2017.[11a] Allerdings bildete die Grundlage damals kein Gesetz, sondern (aus zeitlichen Gründen) nur ein Dekret. Die Walliser Lösung ist auch insofern speziell, als dass der Doppelproporz nicht über den gesamten Kanton, sondern jeweils innerhalb von sechs Wahlregionen (bestehend aus jeweils einem bis drei Wahlkreisen) zur Anwendung kommt.
Interessant ist, dass fünf der sieben Kantone ein Quorum bei der Sitzverteilung kennen, womit es Kleinparteien erschwert wird, ins Parlament einzuziehen. In den meisten Fällen wurde die Sperrklausel gleichzeitig mit dem Wechsel zum Doppelproporz oder kurz danach eingeführt. Einzig im Kanton Wallis galt schon vorher ein Quorum von 8 Prozent, das beibehalten wurde.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die sieben Kantone und ihre Wahlsysteme.
Tabelle 1: Übersicht über die Kantone mit Doppelproporz
| Kanton |
Altes Wahlsystem |
Neues Wahlsystem |
Zahl der Wahl-kreise |
Quorum |
Erste Wahl mit neuem System/
jüngste Wahl
|
| Zürich |
Hagenbach-Bischoff (mit Listenverbindungen) |
Doppelproporz |
18 |
5% in einem Wahlkreis (zur Sitzverteilung im ganzen Kanton zugelassen) |
2007/
2015 |
| Schaffhausen |
Hagenbach-Bischoff (mit Listenverbindungen) |
Doppelproporz |
6 |
– |
2008/
2016 |
| Aargau |
Hagenbach-Bischoff (mit Listenverbindungen) |
Doppelproporz |
11 |
5% in einem Wahlkreis (zur Sitzverteilung im ganzen Kanton zugelassen) oder 3% im Kanton |
2009/
2016 |
| Nidwalden |
Hagenbach-Bischoff (ohne Listenverbindungen) |
Doppelproporz |
11 |
– |
2014/
2018 |
| Zug |
Hagenbach-Bischoff (ohne Listenverbindungen) |
Doppelproporz |
11
|
5% in einem Wahlkreis (zur Sitzverteilung im ganzen Kanton zugelassen) oder 3% im Kanton |
2014/
2018 |
| Wallis |
Hagenbach-Bischoff (ohne Listenverbindungen) |
Doppelproporz (innerhalb von Wahlregionen) |
14 |
8% im Kanton |
2017/
2017 |
| Schwyz |
Hagenbach-Bischoff (ohne Listenverbindungen) |
Doppelproporz |
30 |
1% in einem Wahlkreis (zur Sitzverteilung in der ganzen Wahlregion zugelassen) |
2016/
2016 |
3. Auswirkungen des Doppelproporz auf die Sitzverteilung
3.1. Sitzverschiebungen infolge des Doppelproporz
Um die Auswirkungen des neuen Wahlsystems auf die Sitzverteilung zu untersuchen, wurde jeweils die jüngste Parlamentswahl unter dem Doppelproporz-System betrachtet. Dabei wurde die tatsächliche Sitzverteilung mit der hypothetischen Sitzverteilung unter dem früheren Wahlsystem verglichen. Für die drei Kantone, in denen im Hagenbach-Bischoff-System Listenverbindungen möglich waren, wurde angenommen, dass die gleichen Listenverbindungen eingegangen worden wären wie bei der letzten Wahl unter diesem System.[12] Zur Berechnung der Sitzverteilung wurde das Programm BAZI[13] verwendet.
Zunächst lässt sich feststellen, dass unter dem Doppelproporz-System im Durchschnitt etwa 10 Prozent der Sitze einer anderen Partei zufielen, als dies unter dem Hagenbach-Bischoff-System der Fall gewesen wäre. Am höchsten ist der Anteil im Kanton Schaffhausen, wo 9 von 60 Sitzen oder 15 Prozent den Besitzer wechselten. Am anderen Ende der Skala findet sich der Kanton Wallis, wo nur 8 von 130 Sitzen verschoben wurden. Das dürfte mit der Ausgestaltung des dortigen Wahlsystems zusammenhängen, da Sitzverschiebungen jeweils nur innerhalb der gleichen Wahlregion möglich sind, sowie mit dem relativ hohen Quorum von 8 Prozent, das kleine bis mittelgrosse Parteien von der Mandatsverteilung ausschliesst, sofern sie nicht mit einem Partner eine gemeinsame Liste bilden.
Zu beachten ist, dass die Sitzverschiebungen nicht immer zugunsten oder zulasten der gleichen Parteien ausfallen, sondern sich teilweise aufheben. So fielen beispielsweise der CVP im Kanton Zürich unter dem Doppelproporz 5 Sitze zu, die sie unter dem alten System nicht bekommen hätte. Allerdings kostete ihr der Doppelproporz in einem Wahlkreis auch einen Sitz. Unter dem Strich «gewann» die Partei durch den Systemwechsel also 4 Sitze.
Der Anteil von 10 Prozent der Sitze, die durch das neue System an eine andere Partei gehen, mag hoch erscheinen. Er wird aber relativiert, wenn man betrachtet, wie viele Sitze jeweils von einer Wahl zur nächsten den Besitzer wechseln, wenn das Wahlsystem nicht ändert. Bei den Nationalratswahlen 2015 etwa wechselten 22 Sitze oder 11 Prozent aller Mandate die Parteifarbe. Wenn man bedenkt, dass die Volatilität der Stimmenanteile bei diesen Wahlen eher gering war (selbst für Schweizer Verhältnisse), kann eine durch das Wahlsystem verursachte Verschiebung von 10 Prozent der Sitze kaum als Erdrutsch bezeichnet werden.
3.2. Proportionalität
Interessant ist nun natürlich die Frage, welche Parteien unter dem Doppelproporz mehr Sitze holen als unter dem alten System und auf wessen Kosten. Generell lässt sich sagen, dass grössere Parteien etwas weniger Mandate holen, während kleinere Parteien mehr Sitze erhalten. Dies erstaunt nicht: Am Ursprung der Systemwechsel standen ja die hohen natürlichen Quoren unter den früheren Verteilungsverfahren, die vor allem kleine Parteien benachteiligten. Unter dem Doppelproporz werden die Sitze (mit Ausnahme des Kantons Wallis) über den ganzen Kanton hinweg zugeteilt, was es für kleinere Parteien leichter macht, Mandate zu gewinnen. Zwar relativieren die vielerorts geltenden gesetzlichen Quoren diese Aussage, die gesetzlichen Hürden liegen aber immer noch weniger hoch als die natürlichen Quoren in einigen Wahlkreisen unter Hagenbach-Bischoff.
Daraus lässt sich allerdings nicht schliessen, dass der Doppelproporz kleinere Parteien «bevorteilen» würde. Das wird bereits klar, wenn man die Stimmenanteile der Parteien mit ihren Sitzanteilen vergleicht. Beispielsweise erhielt die SP im Kanton Schaffhausen bei den letzten Wahlen 23 Prozent der Stimmen. Unter dem Hagenbach-Bischoff-Verfahren hätte sie damit 18 von 60 Sitzen im Kantonsrat (also 30 Prozent) geholt. Unter dem Doppelproporz sind es «nur» 14 Sitze, was ziemlich genau der Stärke der Partei entspricht.
Um eine allgemeine Aussage darüber zu gewinnen, wie gut das neue Wahlsystem die Stärken der Parteien im Parlament abbildet, verwenden wir den Gallagher Index of Disproportionality. Dieser misst die Unterschiede zwischen Stimmenanteilen und Sitzanteilen aller Parteien und fasst sie in einer Zahl zusammen, wobei die Differenzen jeweils quadriert werden. Deutliche Abweichungen zwischen dem Rückhalt einer Partei unter den Wählern und ihrer Stärke im Parlament resultieren in einem höheren Indexwert.
Nimmt man den Gallagher Index als Massstab, ist der Trend in allen sieben Kantonen eindeutig: Unter dem Doppelproporz ist die Sitzverteilung deutlich proportionaler, als sie es unter dem alten Wahlsystem war beziehungsweise gewesen wäre. In allen Kantonen sank der Indexwert, zum Teil massiv. Am schwächsten war der Rückgang im Kanton Wallis, was zum einen daran liegt, dass der Doppelproporz nur innerhalb von Wahlregionen und nicht über den ganzen Kanton hinweg zur Anwendung kommt, zum anderen an der hohen 8-Prozent-Sperrklausel. Dennoch hat sich der Wert auch im Wallis mehr als halbiert. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die Auswirkung des Doppelproporz auf die Disproportionalität der Sitzverteilung.

Abbildung 1: Vergleich der Disproportionalität der Sitzverteilung (gemäss Gallagher Index) unter dem alten Wahlsystem (helle Balken) und dem Doppelproporz (dunkle Balken).
3.3. Gegenläufige Sitzvergebungen
Der Doppelproporz verteilt die Sitze so auf die Parteien, dass über den ganzen Kanton hinweg die Sitzanteile möglichst genau den Stimmenanteilen entsprechen. Dies hat den Nachteil, dass innerhalb der Wahlkreise die Proportionalität zuweilen relativiert wird. Wenn beispielsweise eine Partei im Kanton Schwyz in jedem Wahlkreis 5 Prozent der Stimmen holt, hat sie Anspruch auf 5 Sitze. Allerdings hat kein Wahlkreis mehr als 10 Sitze, sodass ein Anteil von 5 Prozent nirgends einen Sitzgewinn garantiert. Weil die Partei die ihnen zustehenden Sitze irgendwo erhalten muss, teilt sie ihr das System tendenziell in jenen Wahlkreisen zu, wo sie aufgrund ihres Stimmenanteils am nächsten an einem Mandat ist. Das kann dazu führen, dass eine Liste in einem Wahlkreis mehr Sitze als eine andere gewinnt, obwohl sie weniger Stimmen erhalten hat.
Allerdings können solche gegenläufigen Sitzvergebungen auch unter dem Hagenbach-Bischoff-Verfahren auftreten, sofern Listenverbindungen erlaubt sind. Ist eine Liste mit einer oder mehreren anderen verbunden, ist es möglich, dass sie dank dieser Verbindung zu einem Mandat kommt, das sonst einer anderen Liste zugefallen wäre.
Doch wie oft kommen gegenläufige Sitzvergebungen in der Praxis vor? Die Analyse zeigt, dass es sich insgesamt um ein eher seltenes Phänomen handelt. Bei den letzten sieben Wahlen unter dem doppeltproportionalen Verfahren fielen lediglich 11 von 750 Sitzen einer Liste zu, obwohl eine andere im betreffenden Wahlkreis mehr Stimmen erhalten hatte. Das entspricht einem Anteil von etwa 1.5 Prozent. Am meisten gegenläufige Sitzvergebungen, nämlich deren 3, gab es im Kanton Schwyz. Das dürfte mit damit zusammenhängen, dass es in Schwyz sehr viele und insbesondere viele kleine Wahlkreise gibt.[14] Die Stimmen, die dort nicht zu einem Sitzgewinn führen, müssen in anderen Wahlkreisen zu Mandaten für die betreffenden Parteien «verwertet» werden.
Interessant ist der Blick auf die drei Kantone, in denen unter dem alten Wahlsystem Listenverbindungen möglich waren (Zürich, Schaffhausen und Aargau). Wäre bei den jüngsten Wahlen das frühere Verfahren zur Anwendung gekommen, hätte es in zwei der drei Kantone mehr gegenläufige Sitzvergebungen gegeben, als unter dem Doppelproporz zu beobachten waren.[15] Dies relativiert die vielfach kritisierten Verzerrungen des Doppelproporz.[16]
4. Weitere Auswirkungen
4.1. Auswahl für die Wähler
Unter dem Doppelproporz sind Stimmen, die in einem Wahlkreis nicht zu einem Sitzgewinn führen, nicht verloren, sondern können der Partei anderswo zu einem Mandat verhelfen. Deshalb haben Parteien einen Anreiz, in möglichst vielen Wahlkreisen Listen aufzustellen, um Stimmen zu sammeln, die ihnen bei der Oberzuteilung helfen. Zu erwarten wäre demnach, dass insbesondere in kleinen Wahlkreisen die Zahl der eingereichten Listen zunimmt.
Der Blick auf die sieben Kantonen lässt den Schluss zu, dass dies tatsächlich der Fall ist. Interessant ist wiederum der Kanton Schwyz: Bei den letzten Wahlen unter dem Hagenbach-Bischoff-System 2012 stand in 9 der 30 Wahlkreisen jeweils nur eine Partei beziehungsweise ein Kandidat – es handelte sich ausnahmslos um Einerwahlkreise – zur Auswahl.[17] Bei den ersten Wahlen unter dem Doppelproporz waren es nur noch 2.[18] Im Durchschnitt aller Wahlkreise stieg die Zahl der antretenden Parteien von 2.6 auf 4.
In den anderen Kantonen lässt sich eine ähnliche Entwicklung feststellen. Von den sieben Kantonen, die zum Doppelproporz wechselten, verzeichneten sechs bei den ersten Wahl unter dem neuen System mehr Parteien.[19] Erstaunlich ist, dass die Zahl der Parteien selbst in Kantonen zunahm, die unter dem alten Wahlsystem Listenverbindungen erlaubt hatten (diese erleichtern kleinen Parteien tendenziell die Kandidatur). Die einzige Ausnahme ist Zürich, wo die durchschnittliche Zahl der Parteien leicht sank, was allerdings fast ausschliesslich auf die Entwicklung in den Stadtzürcher Wahlkreisen zurückzuführen ist.[20]
Ein Effekt, der sich in allen Kantonen zeigt, ist, dass vor allem in kleinen Wahlkreisen die Auswahl für die Wähler markant zunahm. Betrachtet man nur die Wahlkreise mit weniger als drei Sitzen (in allen Kantonen), war die Zahl der Parteien bei der ersten Wahl unter dem Doppelproporz im Schnitt mehr als doppelt so hoch wie zuvor.[21]
4.2. Wahlbeteiligung
Wenn die Auswahl (zumindest in den meisten Wahlkreisen) zunimmt und Stimmen einen Einfluss auf die Sitzverteilung haben, auch wenn die betreffende Partei im Wahlkreis selber chancenlos ist, erhöht sich tendenziell der Anreiz, an der Wahl teilzunehmen. Zu erwarten wäre deshalb, dass die Beteiligung (leicht) zunimmt. Ein Blick auf die Zahlen stützt diese Erwartung indes nicht. In sechs von sieben Kantonen ging die Beteiligung bei den ersten Wahlen unter dem neuen System zurück. Einzig in Nidwalden nahm sie gegenüber den vorangegangenen Wahlen minim zu.
Allerdings ist bei diesen Vergleichen zu berücksichtigen, dass die Beteiligung an kantonalen Wahlen generell rückläufig ist. Aus diesem Grund wurden die Veränderungen der Entwicklung in sämtlichen Kantonen in der gleichen Periode gegenübergestellt. Auch diese Rechnung zeigt aber keinen positiven Effekt des Doppelproporz auf die Wahlbeteiligung. In fünf von sieben Kantonen entwickelte sich die Wahlbeteiligung bei den ersten Wahlen unter dem neuen Wahlsystem schlechter als der Durchschnitt aller Kantone.[22]
Natürlich ist das Wahlsystem nur einer von mehreren (möglichen) Einflussfaktoren für die Wahlbeteiligung. Die Parteienkonkurrenz, die wahrgenommene Bedeutung des betreffenden Urnengangs, die Zugänglichkeit der Stimmabgabe oder die Demografie spielen ebenfalls eine Rolle, mutmasslich sogar eine grössere. Um den Einfluss des Wahlsystems zu identifizieren, wäre eine detailliertere Analyse nötig, die den Rahmen dieses Artikels sprengt. Zumindest lassen aber die hier erhobenen Daten den Schluss zu, dass der Doppelproporz insgesamt wohl keinen positiven Einfluss auf die Beteiligung hatte.
Interessant ist allerdings wiederum der Blick auf die kleinen Wahlkreise: Dort weist der Trend vielerorts in die andere Richtung. Während beispielsweise bei den Kantonsratswahlen 2016 im Kanton Schwyz die Beteiligung insgesamt um fast 6 Prozentpunkte zurückging, wuchs sie in den Einerwahlkreisen um rund 2 Prozentpunkte.[23] In den anderen Kantonen halten sich positive und negative Trends die Waage, wobei die Zahl der Beobachtungen dort deutlich kleiner ist (es gibt insgesamt nur 6 kleine Wahlkreise, während es in Schwyz deren 17 sind).
5. Fazit
Wahlsysteme setzen den demokratischen Anspruch in die Realität um und legen dabei unterschiedlichen Wert auf bestimmte Aspekte oder Ziele; sie beeinflussen die Parteienlandschaft[24] und sind gerade deshalb oft umstritten.[25]
Der vorliegende Artikel hat untersucht, wie sich die Einführung eines neuen Wahlsystems, konkret des Doppelproporz, in sieben Kantonen auswirkt. Der Doppelproporz gibt dem Ziel ein grosses Gewicht, dass jeder Wähler möglichst frei entscheiden und den gleichen Einfluss auf das Wahlresultat ausüben kann, unabhängig davon, in welchem Wahlkreis er wohnt und welche Partei er wählt. Ausserdem sucht er eine möglichst proportionale Verteilung der Sitze auf die Parteien sowohl im gesamten Wahlgebiet als auch in den einzelnen Wahlkreisen zu erreichen.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Doppelproporz diese beiden Ziele erreicht. Zum einen wird die Erfolgswertgleichheit besser gewährleistet als unter dem Hagenbach-Bischoff-System. Zum anderen ist die Sitzverteilung deutlich proportionaler. Die konkrete Folge davon ist, dass tendenziell grosse Parteien, die im Hagenbach-Bischoff-System bevorteilt werden, unter dem Doppelproporz weniger Sitze erhalten. Man kann dies als Nachteil auffassen, wenn es darum geht, im Parlament möglichst leicht Mehrheiten zu beschaffen (wobei dies in klassischen parlamentarischen Systemen mit Regierung und Opposition wichtiger ist als in der Schweiz mit ihrem Mischsystem). Dem Anspruch eines Proporzsystems wird dieses Ergebnis aber besser gerecht.
Wie viele Sitze aufgrund des neuen Wahlsystems anders verteilt werden, hängt vom Kontext ab; im Durchschnitt der untersuchten Kantone sind es etwa zehn Prozent aller Mandate. Der Doppelproporz führt also durchaus zu Veränderungen bei der Zusammensetzung des Parlaments, aber nicht zu politischen Erdbeben.
Der Preis der genauen Abbildung der Parteistärken in der gesamtkantonalen Sitzverteilung können Abstriche bei der Proportionalität in einzelnen Wahlkreisen sein. Diese halten sich indes in Grenzen. Gegenläufige Sitzvergebungen treten lediglich bei 1.5 Prozent der Mandate auf.
Eine weitere Auswirkung des Doppelproporz besteht darin, dass die Auswahl für die Wähler insbesondere in kleinen Wahlkreisen grösser ist. In Wahlkreisen mit einem oder zwei Sitzen hat sich die Zahl der Listen, die zur Wahl stehen, im Durchschnitt mehr als verdoppelt. Hingegen lassen die Daten nicht den Schluss zu, dass der Doppelproporz zu einer höheren Wahlbeteiligung führt – die Partizipation hat im Gegenteil in den meisten Kantonen abgenommen, auch wenn der Trend in kleinen Wahlkreisen positiver ist.
Der Entscheid für ein bestimmtes Wahlsystem ist ein politischer. Bei der gegenwärtig diskutierten Frage, wie gross die Freiheit der Kantone bei der Ausgestaltung ihres Wahlrechts sein soll, geht es letztlich darum, wie weitreichend die Kompetenz der (kantonalen) Politik und wie weitgehend jene der Justiz sein soll.
Klar ist, dass das Bundesgericht den Kantonen nicht ein bestimmtes Wahlsystem vorschreiben kann. Der Vorteil des Doppelproporz besteht darin, dass er die Wahlrechtsgleichheit gewährleistet, während gleichzeitig die bestehenden Wahlkreise beibehalten werden können. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Verfahren sind gut, die Einhaltung der Wahlrechtsgleichheit und die Proportionalität der Sitzverteilung werden damit verbessert, wie auch die vorliegende Analyse bestätigt. Die teilweise erbitterte Opposition gegen den Doppelproporz erscheint im Rückblick daher übertrieben und ist wohl zu einem wesentlichen Teil mit parteipolitischen Interessen zu erklären.[26]
[1] Oft wird auch vom «Pukelsheim-System» oder vom «doppelten Pukelsheim» gesprochen, nach dem Mathematiker Friedrich Pukelsheim, der das Verfahren massgeblich entwickelt hat.
[2] Der Kanton Uri hat bislang noch kein neues Wahlsystem eingeführt, muss dies gemäss Bundesgerichtsurteil vom Oktober 2016 aber bis zu den nächsten Landratswahlen im Jahr 2020 tun. Der Regierungsrat schlägt ein Mischwahlsystem vor, bei dem in den kleinsten Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt wird und in den anderen nach dem Doppelproporz.
[3] Entwurf für einen Bundesbeschluss über die Souveränität der Kantone bei der Festlegung ihrer Wahlverfahren, BBl 2018 19.
[4] Siehe zur Entstehungsgeschichte: Claudio Kuster, «Ein ‹Bundesgesetz gegen die wahlrechtliche Beschneidung Lausannes?›», Napoleon’s Nightmare, 1. Juni 2015.
[5] Vgl. Thomas Poledna (1988): Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen.
[6] Das Bundesgericht erachtet Verstösse gegen die Erfolgswertgleichheit unter gewissen Bedingungen als zulässig, namentlich, wenn diese durch geografische, historische, sprachliche, religiöse etc. Gegebenheiten begründet sind. Macht ein Kanton jedoch von der Möglichkeit des Doppelproporzes (oder anderer wahlkreisübergreifender Ausgleichsmassnahmen) keinen Gebrauch, lassen sich im Proporzwahlverfahren Wahlkreise, die gemessen am Leitwert eines grundsätzlich noch zulässigen natürlichen Quorums von 10 % deutlich zu klein sind, selbst dann nicht mehr rechtfertigen, wenn gewichtige Gründe wie die obengenannten für die Wahlkreiseinteilung bestehen (BGE 143 I 92 E. 5.2).
[7] Diesen Weg wählte einzig der Kanton Thurgau mit der Bezirksreform 2009.
[8] Die Kantone Luzern und Freiburg konnten auf diese Weise ihr Wahlsystem bundesrechtskonform ausgestalten.
[9] BGE 1C_59/2012 vom 26. September 2014.
[10] Auf kommunaler Ebene hat die Stadt Zürich den Doppelproporz eingeführt; er kam temporär auch im Nachgang von Gemeindefusionen etwa in den Städten Schaffhausen oder Aarau zur Anwendung.
[11] Der Kanton Schaffhausen führte den Doppelproporz 2008 im Nachgang einer Verkleinerung des Kantonsrats von 80 auf 60 Mitglieder ein.
[11a] Der Kanton Wallis wählte überdies am 25. November 2018 einen Verfassungsrat, der ebenfalls im Doppelproporz gewählt worden ist.
[12] Parteien, die unter dem alten Wahlsystem in einem Wahlkreis nicht angetreten waren, wurden nur dann einer Listenverbindung in diesem Wahlkreis zugeordnet, wenn sie überall sonst, wo sie antraten, mit der/den gleichen Partei(en) eine Listenverbindung eingegangen waren.
[13] https://www.math.uni-augsburg.de/htdocs/emeriti/pukelsheim/bazi/
[14] Siehe zur Konstellation im Kanton Schwyz auch: Claudio Kuster, «Doppelproporz Schwyz: ‹Kuckuckskinder› nicht im Sinne der Erfinder», Napoleon’s Nightmare, 2. März 2015.
[15] Man könnte dies als Argument gegen Listenverbindungen verwenden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es ohne Listenverbindungen zwar keine gegenläufigen Sitzvergebungen gegeben hätte, dafür wäre die Disproportionalität in zwei von drei Kantonen noch höher gewesen. Listenverbindungen führen also tendenziell zu einer besseren Abbildung der Parteistärken im Parlament zum Preis möglicher Verzerrungen in einzelnen Wahlkreisen.
[16] Vgl. etwa Schweizerische Bundeskanzlei, «Proporzwahlsysteme im Vergleich», Seite 18.
[17] In den meisten Fällen erhielten auch einzelne «Diverse» Stimmen. Diese Kategorie wurde als Partei beziehungsweise Kandidat gezählt, sofern sie mindestens 10 Prozent der Stimmen ausmachte.
[18] Dass es überhaupt noch Wahlkreise ohne Parteienkonkurrenz gab, hat damit zu tun, dass die Hürden, um eine Liste einzureichen, nach wie vor relativ hoch sind: Der Wahlvorschlag muss von fünf bis 25 Stimmberechtigten (je nach Wahlkreisgrösse) unterzeichnet werden – in einem Wahlkreis wie Riemenstalden (52 Stimmberechtigte) kein leichtes Unterfangen.
[19] Bei dieser Zählung wurden separate Listen, die klar mit einer bestimmten Partei assoziiert waren, dieser zugerechnet (z.B. Jungparteien-Listen oder regionale Listen).
[20] Viele Parteien traten bei den Wahlen 2003 nur in einem Wahlkreis an, teilweise handelte es sich um Spassparteien.
[21] Dieses Ergebnis dürfte für den Kanton Uri aufschlussreich sein, welcher sein Wahlsystem überarbeiten muss. Die Regierung schlägt vor, dass in Wahlkreisen mit mehr als zwei Sitzen künftig der Doppelproporz zur Anwendung kommt. In den kleinen Wahlkreisen, also dort, wo die Auswirkungen des Doppelproporz besonders relevant sind, soll hingegen weiter im Majorzverfahren gewählt werden.
[22] Der Effekt scheint nicht auf eine generelle «Demokratiemüdigkeit» in den betreffenden Kantonen zurückzuführen sein. Jedenfalls zeigt ein Blick auf die Beteiligungsraten bei nationalen Volksabstimmungen, dass diese sich in den sieben Kantonen in etwa gleich gut (beziehungsweise schlecht) entwickelte wie im Rest des Landes.
[23] Aufschlussreich ist, dass die Beteiligung dort besonders stark zulegte, wo die Zahl der kandidierenden Parteien am stärksten wuchs.
[24] Maurice Duverger (1951): Les Partis Politiques.
[25] Andrea Töndury: «Der ewige K(r)ampf mit den Wahlkreisen», in: Andrea Good, Bettina Platipodis (Hrsg.): Direkte Demokratie. Herausforderungen zwischen Politik und Recht. Festschrift für Andreas Auer zum 65. Geburtstag.
[26] Die detaillierten Zahlen, auf denen diese Analyse beruht, können hier abgerufen werden.


























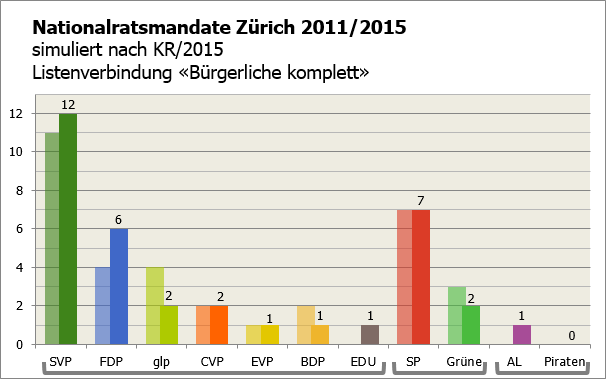






Recent Comments