Aus dem Bücher-Jahrgang 2024 hat die «Napoleon’s Nightmare»-Redaktion ein Dutzend demokratierelevante Favoriten herausgepickt. Die Neuerscheinungen beleuchten die US-Wahlen, die Digitalisierung, den Liberalismus und Illiberalismus, die Schweizer Abstimmungsgeschichte, die Umweltverfassung und das Parlamentsrecht.
Von Claudio Kuster und Lukas Leuzinger
 Marina Weisband: Die neue Schule der Demokratie – Wilder denken, wirksam handeln (S. Fischer)
Marina Weisband: Die neue Schule der Demokratie – Wilder denken, wirksam handeln (S. Fischer)
«Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Demokraten von selbst heranwachsen, gleichsam aus der Luft fallen und ab ihrem 16. oder 18. Lebensjahr, wenn sie das erste Mal wahlberechtigt sind, automatisch das tun, was man bei guten Demokraten eben voraussetzt.» Marina Weisband, Publizistin, Psychologin und IT-Nerd, zeigt in ihrem Buch «Die neue Schule der Demokratie» daher anschaulich auf, wie wirkungsvolle schulische Demokratieförderung aussehen sollte. Zwar gebe es Staatskundeunterricht und da und dort Planspiele. Aber das sei «nur Unterrichtsstoff», Schule an sich funktioniere nicht demokratisch. Dabei sei es essenziell für Kinder und Jugendliche, zu lernen und selbst zu erfahren, dass sie nicht hilflos einem System ausgeliefert seien, sondern Gestalter sein könnten.
Hier setzt die von Weisband mitentwickelte Software «Aula» an, die mittlerweile an zahlreichen Schulen in Deutschland und an einigen im Ausland läuft. Die Schüler können ihre Ideen und Wünsche, wie ihr Schulalltag verbessert werden könnte, niederschwellig in «Aula» einspeisen. Die Inputs können darauf klassenübergreifend von den Mitschülern «geliket», kommentiert und mit Gegenanträgen ergänzt werden. Die Kinder, deren Ideen eine bestimmte Zustimmungsrate erreicht haben, gehen darauf in die verschiedenen Klassen und präsentieren ihr Projekt, versuchen, Interesse zu wecken und Einwände aufzugreifen, um die Idee zu optimieren.
«Das Entscheidende ist, dass sich die Schüler mit Themen beschäftigen, die die ihren sind, für die sie sich interessieren, die in ihrem Leben eine Bedeutung haben.» Wären es irgendwelche beliebigen Übungsprojekte, würde es nicht klappen. Natürlich dürfen via «Aula» (Akronym für «ausdiskutieren und live abstimmen») keine Lehrer entlassen oder Geld verprasst werden, das gar nicht vorhanden ist. Bereits der vielerorts geforderte spätere Unterrichtsbeginn lässt sich hierdurch nicht einführen, da dieses Ansinnen gegen Gesetze verstossen würde. Ein breiter Spielraum ihrer kreativen Entfaltung und Selbstbestimmung bleibt den Kindern und Jugendlichen gleichwohl: Die Hausordnung anpassen, Veranstaltungen durchführen oder kleinere Anschaffungen tätigen. An einer Schule wurde so ein Fussballtor auf dem Schulhof aufgebaut, an einer anderen ein Kräutergarten angelegt.
Selbst die Unterrichtsform lässt sich beeinflussen, hat eine Schule doch beschlossen, dass die Lehrer einen Tag lang den Unterricht ausschliesslich mit dem Smartphone zu gestalten haben. Aus der einmaligen Aktion wurde gar ein regelmässiger, monatlicher «Smartphone-Tag». Ein bisschen erstaunlich (auch demokratietheoretisch) ist einzig, dass die Promotoren einer Idee nach gewonnener Abstimmung auch gleich verantwortlich für deren Umsetzung sind: statt Gewaltenteilung eine grobe Vermischung von Legislative und Exekutive. Weisbands Buch ist ein fesselndes und überzeugendes Plädoyer für praxisnahe Demokratiebildung, das von ihrem breiten Erfahrungsschatz aus Politik, Bildungswesen, Psychologie und Informatik profitiert.
 Christian R. Ulbrich & Bruno S. Frey: Automated Democracy – Die Neuverteilung von Macht und Einfluss im digitalen Staat (Herder)
Christian R. Ulbrich & Bruno S. Frey: Automated Democracy – Die Neuverteilung von Macht und Einfluss im digitalen Staat (Herder)
Die Luca-App sollte in Deutschland helfen, Corona-Ansteckungswege zu verfolgen. Doch als 2021 ein Mann nach dem Verlassen einer Gaststätte in Mainz stürzte und starb, nutzte die Polizei die App kurzerhand, um Zeugen ausfindig zu machen. Kurz darauf regte der rheinland-pfälzische Justizminister an, die Daten der Luca-App auch in anderen Fällen für die Strafverfolgung zu nutzen. Das Beispiel zeigt ein Dilemma der Digitalisierung für die Staatstätigkeit. Zum einen erlauben es digitale Technologien, staatliche Tätigkeiten effizienter auszuführen. Zum anderen ermöglichen sie aber auch eine immer engmaschigere Überwachung der Bürger.
In «Automated Democracy» beleuchten Christian L. Ulbrich und Bruno S. Frey die Herausforderungen der digitalen Technologien für die Demokratie. Aus ihrer Sicht spielen diese generell Autokratien in die Hände. Denn Effizienzsteigerungen bedeuten stets auch effizientere Kontrollmöglichkeiten. Gleichwohl sehen sie Möglichkeiten und machen konkrete Vorschläge, wie die Digitalisierung im Sinne der Demokratie genutzt werden kann. So regen sie an, Parlamente digital aufzurüsten. Auch schlagen sie dezentrale digitale Infrastrukturen vor, die auf harmonisierten Standards beruhen. Diese würden den Föderalismus stärken und wären zugleich widerstandsfähiger gegen Störungen.
Originell ist schliesslich die Idee, gewisse Bereiche, etwa besonders grundrechtsrelevante, als «analoge Enklaven» von der digitalen Datenerfassung und -bearbeitung auszunehmen. Was solche Vorschläge tatsächlich bringen, kann man diskutieren. Die Stärke des Buches liegt darin, dass Ulbrich und Frey weder als technologiefeindliche Maschinenstürmer auftreten noch als naive Enthusiasten. Vielmehr analysieren sie die Herausforderungen scharfsinnig und machen kreative Vorschläge, um sie zu bewältigen.
 Ronald D. Gerste: Amerikas Präsidentschaftswahlen – Von George Washington bis zu Donald Trump (NZZ Libro)
Ronald D. Gerste: Amerikas Präsidentschaftswahlen – Von George Washington bis zu Donald Trump (NZZ Libro)
«John F. Kennedy: 100 Fragen – 100 Antworten», «Roosevelt und Hitler», «Trinker, Cowboys, Sonderlinge: Die 13 seltsamsten Präsidenten der USA» bis hin zu «Die First Ladies der USA: von Martha Washington bis Hillary Clinton»: Ronald D. Gerste, in Washington lebender Augenarzt und Historiker, hat in den letzten gut zwanzig Jahren bereits etwa ein Dutzend Bücher zur Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, mit besonderem Fokus auf ihre Präsidenten, geschrieben. Gerste ist daher prädestiniert, auch eine kleine Geschichte der US-Präsidentschaftswahlen, «von George Washington bis zu Donald Trump», vorzulegen.
Glücklicherweise tappt er dabei nicht in die Falle, ein vollständiges (dafür dröges) Lexikon aller bisherigen 59 Präsidentschaftswahlen hintereinander zu reihen. Stattdessen stellt Gerste in 16 knappen, sehr gut lesbaren und unterhaltsamen Kapiteln jeweils eine oder zwei aufeinanderfolgende historische Wahlen vor, die sich als besonders spannend oder kurios, als paradigmatisch oder als besonders knapp und umstritten erwiesen haben. So etwa 1960, als es zum ersten Mal zu einer landesweit, von Maine bis Hawaii übertragenen Debatte zwischen den beiden Spitzenkandidaten John F. Kennedy und Richard Nixon kam. Und JFK im neuen Medium Fernsehen Nixon alt aussehen liess. Das Fernsehduell hat seither eine Hauptrolle auf der Bühne des elektoralen Willensbildungsprozesses eingenommen.
Weitere erwähnenswerte Wahlen aus fernen Tagen sind jene des Gründervaters George Washington 1788/89, die von Abraham Lincoln während des Amerikanischen Bürgerkriegs 1864 oder von Franklin D. Roosevelt in der Great Depression 1932. In 14 weiteren, kurzen Zwischenkapiteln erfährt man lehrreiche «Facts», etwa, wie die Vorwahlen «Caucus» und «Primary» ablaufen, was am «Inauguration Day» passiert oder was die Funktion der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten ist. Oder dass Attentate auf US-Präsidenten gar nicht so selten sind: Gleich vier Präsidenten schieden so aus dem höchsten Amt und Leben.
Über all diese Wahlgänge der vergangenen 235 Jahre hinweg lassen sich auch einige Umstände respektive Motive erkennen, die eine Präsidentschaft respektive das Wahlverhalten wiederkehrend geprägt haben: So war beispielsweise der – hier verheimlichte, dort offenkundige – Gesundheitszustand der Präsidenten eine regelmässige Begleiterscheinung. Ebenfalls spielten immer wieder Ressentiments gegen die Vertreter der «Ostküsten-Elite» eine Rolle – beides Faktoren, die auch bei den jüngsten Wahlen 2024 einschlägig sein sollten. Im Hinblick auf jenes Fanal (bei Drucklegung hiess es noch Joe Biden vs. Donald Trump) schliesst der Autor sein durchwegs empfehlenswertes Buch im Epilog in eher düsteren Farben: «Die Wahl von 2024 ist ein Referendum über die Zukunft der Demokratie in den USA und über die Zukunft von Amerikas Rolle in der Welt.»
 Horst Dreier: Metamorphosen der Demokratie (Schwabe)
Horst Dreier: Metamorphosen der Demokratie (Schwabe)
Wenn heute über die Demokratie nachgedacht wird, so wird dem Zustand dieser Herrschaftsform wahrscheinlich relativ bald die Diagnose «Krise» attestiert. Die Krise als Begleiter der Demokratie ist jedoch kein Novum, sondern permanentes Attribut. Horst Dreier (emeritierter Rechtswissenschaftler und -philosoph, Herausgeber eines Kommentars zum Deutschen Grundgesetz) geht in seinem knappen Essay «Metamorphosen der Demokratie» der Frage nach, ob die Demokratie – jenseits von aktuellen Herausforderungen und Defiziten – grösseren, strukturellen und längerfristigen Veränderungsprozessen unterworfen ist.
Historisch verortet Dreier nur eine einzige Metamorphose, welche die Demokratie tiefgreifend umgeformt hat: die Transformation der ursprünglich direkten Demokratie hin zur repräsentativen Form. Diesem Umschwung werden die ersten beiden Kapitel gewidmet. In aller Kürze wird das Demokratiemodell des antiken Athens in Erinnerung gerufen, das sich durch eine unmittelbare Teilhabe durch eine breite Bürgerschaft in Volksversammlungen auszeichnete. Die Wandlung hin zur repräsentativen Demokratie vollzog sich erstmals Ende des 18. Jahrhunderts im Grossflächenstaat USA.
Vor diesem Hintergrund beleuchtet Dreier vier neuere Entwicklungen, zunächst die Supranationalisierung in den EU-Mitgliedsstaaten, die «massive Abwanderungsprozesse ursprünglich staatlicher Hoheitsrechte auf die Europäische Union» zur Folge habe. Das Ganze sei weniger problematisch, wenn auf europäischer Ebene ein gleichwertiges demokratisches Legitimationssystem wie auf nationaler Ebene vorzufinden wäre. Doch dies sei gerade nicht der Fall, weshalb die «Europäisierung zu empfindlichen Einbussen bei der demokratischen Organisation und Legitimation der Ausübung öffentlicher Gewalt» führe. Analoges gelte für die Internationalisierung und Globalisierung – etwa in der Form der Welthandelsorganisation.
In beiden Fällen werde letztlich «Hoheitsgewalt ausgeübt, für die ein legitimatorischer Rückgriff auf die politische Selbstbestimmung des Staatsvolks nicht mehr möglich erscheint». Nebst der Migration (die zu einem Auseinanderklaffen von Herrschenden und Herrschaftsbetroffenen führe) identifiziert Dreier einen durch Digitalisierung und soziale Medien verursachten Strukturwandel der demokratischen Öffentlichkeit, den er nicht pessimistisch, immerhin aber ambivalent betrachtet. – Dreiers (leider ein wenig lapidares) Fazit: Die beleuchteten Problemkreise würden zwar zu einer Erosion der Demokratie führen, eine eigentliche zweite Metamorphose läuteten sie jedoch nicht ein.
 Georg Müller, Felix Uhlmann & Stefan Höfler: Elemente einer Rechtssetzungslehre (4. Auflage) (Schulthess)
Georg Müller, Felix Uhlmann & Stefan Höfler: Elemente einer Rechtssetzungslehre (4. Auflage) (Schulthess)
Ursprünglich 1999 als Buch zu einer Vorlesung von Staatsrechtslehrer Georg Müller hervorgegangen, sind die «Elemente einer Rechtssetzungslehre» unterdessen in vierter Auflage erschienen. Die Autorenschaft wird nun um Felix Uhlmann und Stefan Höfler ergänzt (beide Leiter des Zentrums für Rechtsetzungslehre). Die Monografie richtet sich weiterhin an Rechtswissenschaftler ebenso wie an Praktikerinnen. – Im Einleitungsteil «Grundfragen der Rechtsetzung» werden die Erwartungen und Funktionen der Rechtsetzung umrissen und letztere von der Rechtsanwendung und vom Soft Law abgegrenzt. Vertieft wird hier die Qualitätssicherung, wie sich also das so häufig beklagte «schlechte Gesetz» vermeiden lässt. Stichworte sind hier: Regulierungsfolgenabschätzung, ex post Evaluationen, Simulationen, Checklisten; nur kurz gestreift wird die künstliche Intelligenz.
Im zweiten (Haupt-)Teil werden die Phasen des Rechtssetzungszyklus vertieft, der sich von der Impulsgebung, der Ist-Analyse und des Normkonzept über die Redaktion und Konsultation bis hin zur Beschlussfassung und Inkraftsetzung dreht. Eine wichtige Frage ist die Wahl der Regulierungsinstrumente, wobei hier nebst dem klassischen Gebot/Verbot oft auch Anreize, Subventionen, Lenkungsabgaben, staatliche Informationen, Nudging oder Selbstregulierung ebenso zielführend sind. Den aus dem Politalltag bekannte Vorwurf «das gehört nicht in die Verfassung/ins Gesetz» versuchen die Autoren mit dem Wichtigkeitsbegriff zu objektivieren. Ein ebenfalls sehr praxisrelevantes, durch den Linguisten Höfler geprägtes Kapitel betrifft die Erlassredaktion. Hier werden rechtslinguistische Fragen diskutiert: Wie gliedert man ein Gesetz? Sind Verweise auf andere Erlasse sinnvoll? Und welche geschlechtergerechten Formulierungen sollte man (nicht) verwenden?
Teil drei beleuchtet die «Organe der Rechtsetzung», insbesondere das Verhältnis Bund und Kantone sowie das Zusammenwirken von Regierung, Verwaltung und Parlament. Weitere Akteure betreffen das Lobbying, die Volksrechte und die Rechtsetzung durch Private. Erstaunlich ist hier, dass sich das Parlament «im Wesentlichen mit der politischen Kontrolle des ‹Produkts›» begnüge. Daher sollte gar das Antragsrecht der einzelnen Parlamentsmitglieder auf Änderung der Gesetzesvorlagen aufgehoben werden. Solche anachronistische Parlamentarismus-Kritik hat sich leider seit 1999 praktisch unverändert bis in die neuste Auflage hindurchziehen können, obschon der – durch Kurt Eichenberger und seine äusserst exekutivstaatliche Haltung geprägte – Erstautor unterdessen durch zwei jüngere und mit der Legislative kaum auf Kriegsfuss stehende Co-Autoren sekundiert wird. Der vierte Teil schliesslich widmet sich der «Interkantonalen und internationalen Rechtssetzung», die in letzter Zeit stark an Verbreitung gewonnen hat. Hervorzuheben ist hier die Bedeutung des Konsenserfordernisses für die Ausgestaltung von bi- und multilateralen Regelungen. Ein letztes Kapitel beleuchtet die Tücken der «Übernahme von EU-Recht».
Die Erstauflage wurde damals fast entschuldigend eingeleitet, die «Grundzüge einer einigermassen geschlossenen Rechtssetzungslehre» vorzulegen, sei nicht erreicht worden, es sei «bei Fragmenten geblieben». Das war natürlich stark untertrieben – nachdem das baldige Standardwerk noch interdisziplinär erweitert und verdichtet wurde, gilt das erst recht.
 Lorenz Engi: Die Dramatisierung der Welt – Über Illiberalismus (Claudius)
Lorenz Engi: Die Dramatisierung der Welt – Über Illiberalismus (Claudius)
Die Klage über den Aufstieg des Illiberalismus ist inzwischen weit verbreitet. Lorenz Engis Analyse hebt sich von anderen ab dadurch, dass er den Aufstieg in einen grösseren Kontext bettet. Er stellt eine generelle «Entzauberung» fest, die sich in der Politik, aber auch in der Wissenschaft und der Kultur beobachten lässt. Engi sieht als Gründe dafür vor allem die Ausbreitung der Technik sowie die Bürokratisierung.
In der Politik kommt hinzu, dass die nationale Politik durch die Globalisierung an Bedeutung verloren hat. War die Politik im 20. Jahrhundert «wie wahrscheinlich niemals vorher und nachher ein Ort von Hoffnungen, Träumen und Ängsten», wechselte sie nach 1989 in einen «funktionalen Modus». Den Illiberalismus sieht Engi zu einem grossen Teil als Reaktion darauf.
Der Jurist verweist warnend auf die Gefahren, wenn der Staat zum Träger einer kollektiven Moral gemacht wird und die Macht zunehmend personalisiert wird. Doch er versteigt sich nicht in moralische Empörung, sondern bleibt in seiner Analyse stets nüchtern und konzis. Das macht sie zu einem wertvollen und lesenswerten Beitrag zur aktuellen Debatte.
 Martin Graf & Andrea Caroni (Hrsg.): Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung – Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) (2. Auflage) (Helbing Lichtenhahn)
Martin Graf & Andrea Caroni (Hrsg.): Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung – Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) (2. Auflage) (Helbing Lichtenhahn)
Bauernpräsident und Bundesratskandidat Markus Ritter, einer der versiertesten und erfolgreichsten Lobbyisten unter der Bundeshauskuppel, hat ihn stets griffbereit auf dem Nachttisch liegen: den Gesetzeskommentar zum Parlamentsgesetz. Vor zehn Jahren erstmals erschienen, ist der Kommentar zur Reglementierung der Schweizerischen Bundesversammlung nun in zweiter Auflage überarbeitet und ergänzt worden. Das Herausgeberduo umfasst weiterhin Martin Graf (ehem. Sekretär der Staatspolitischen Kommissionen) und neu Andrea Caroni (Ständerat und Staatsrechtler).
Anlass für ein Update gibt es genug: Seit 2014 wurde das Parlamentsgesetz neun Mal revidiert, Dutzende Artikel haben kleinere oder grössere Änderungen erfahren. So wurden die Offenlegungspflichten der Parlamentsmitglieder erweitert. Und seit kurzem wird endlich das Abstimmungsverhalten der Mitglieder des Ständerats integral offengelegt. Niederschlag gefunden haben aber vor allem die Erfahrungen aus der Pandemie. Nachdem sich nicht wenige Regelungen als kaum krisentauglich erwiesen haben, hat die Bundesversammlung an etlichen Stellen nachgebessert: Ausserordentliche Sessionen und die Behandlung von Motionen können beschleunigt werden, die Verschiebung und der Abbruch von Sessionen wurden geregelt, nötigenfalls können die Kommissionen oder gar der gesamte Nationalrat und Ständerat virtuell tagen.
Wie schon die Erstauflage zeichnet sich der Kommentar dadurch aus, dass er nicht bloss eine juristische Auslegung der Normen vornimmt, sondern auch relativ ausführlich die jeweilige Entstehungsgeschichte sowie politologisch-praktische Aspekte beleuchtet. Ein Grossteil der 22 Autorinnen und Autoren arbeitet für die Parlamentsdienste, wodurch viel exklusives Knowhow einfliesst und die Praxisrelevanz sichergestellt wird. Die Nähe gerät aber auch da und dort zum Nachteil, etwa wenn der Beitrag über die weiterhin vertraulichen Kommissionsunterlagen und -protokolle keinerlei Kritik an diesem Reservat der Intransparenz übt. Eine rechtsvergleichende Betrachtung wäre hier zu anderen Schlüssen gelangt. Als ansonsten einziger Kritikpunkt anzumerken bleiben die leider teilweise lückenhaften Literaturhinweise: Während eigene Publikationen (oder gar blosse Wortmeldungen) der Autoren ausführlich referenziert werden, fehlen andere wichtige Abhandlungen, die sich mit parlamentarischem Verfahrensrecht befassen (beispielsweise Corsin Bisaz, Direktdemokratische Instrumente).
Der Parlamentskommentar stellt weiterhin ein unentbehrliches Nachschlagewerk für alle Personen dar, die sich mit dem Parlament beschäftigen: Journalistinnen, Lobbyisten, Verwaltungsangestellte und letztlich die Parlamentarier selbst. Egal ob weiterhin als Nationalrat und Bauernvertreter oder bald als Bundesrat: auf Markus Ritters Nachttisch dürfte die Neuauflage sicherlich auch schon liegen. Damit er seinen politischen Kontrahenten weiterhin stets einen Schritt voraus ist.
 David Hesse & Philipp Loser: Heute Abstimmung! – 30 Volksentscheide, die die Schweiz verändert haben (Limmat)
David Hesse & Philipp Loser: Heute Abstimmung! – 30 Volksentscheide, die die Schweiz verändert haben (Limmat)
Die Schweiz wäre nicht die Schweiz, wie sie heute ist, hätte nicht der Souverän dereinst an der Urne so entscheiden. Wir könnten in einem Zwei-Parteien-System leben, bestehend lediglich aus Liberalen und Sozialisten (doch wurde 1918 der Proporz eingeführt). Unser Strom könnte hauptsächlich aus Atomkraftwerken stammen (was 1990 verhindert wurde). Oder könnten wir gar Mitglied der EU sein (2001 verworfen). Die beiden Journalisten und Historiker David Hesse und Philipp Loser porträtieren in ihrem Buch «Heute Abstimmung!» jene 30 Volksentscheide, die ihrer Ansicht nach das Land am stärksten und nachhaltigsten verändert und geprägt haben.
Die Auswahl dieser 30 «wichtigsten» nationalen Volksabstimmungen zwischen 1874 (Totalrevision Verfassung) und 2014 (Initiative «gegen Masseneinwanderung») folgt indes keinem wissenschaftlichen Konzept, wie die Autoren freimütig einräumen. Einem werdenden Elternpaar gleich, das sich Listen mit Namensvorschlägen für ihren Nachwuchs hin- und herschiebt, haben Hesse und Loser ihre «Best of»-Tabellen ausgetauscht, zusammengestrichen, mit Experten besprochen. Und sind so bei 30 Vorlagen gelandet (13 Volksinitiativen, 9 fakultativen und 8 obligatorischen Referenden), die wohl grösstenteils auch objektiven Kriterien genügen würden – so etwa die Klassiker Überfremdung (1979), Frauenstimmrecht (1971), EWR (1992), Fristenlösung (2002) und Ausschaffung (2010).
Einzig hinter drei Vorlagen ist ein Fragezeichen zu setzen, da sie dem Kriterium kaum genügen: Auslandschweizer-Artikel (1966; betraf relativ wenig Personen), Jura-Gründung (1978; Bundesabstimmung war reine Formsache), Gurtenobligatorium (1980; kaum Langfristwirkung). Umgekehrt haben institutionelle Änderungen gegenüber alltagsrelevanten Sachabstimmungen ein bisschen das Nachsehen. Enorme Auswirkungen zeitigte beispielsweise die Einführung des «Doppelten Ja» bei Initiativen mit Gegenentwurf (1987; siehe Der «Geburtsfehler» der Volksinitiative). Erst diese kleine Anpassung des Stimmzettels führte dazu, dass Initiativen seit den 1990er Jahren nicht mehr mit taktischen Gegenvorschlägen ausgebremst werden können. Seither steig die Annahmequote denn auch merklich an. Andere wichtige Reformen waren die Totalrevision der Bundesverfassung (1999), Justizreform (2000), Bilaterale I (2000), Neugestaltung Finanzausgleich/Aufgabenteilung (2004), Bilaterale II/«Schengen/Dublin» (2005) und die Bildungsverfassung (2006). Auch diese schafften es allesamt nicht in Hesse/Losers «Top 30».
Doch die genaue Auswahl ist letztlich gar nicht so wichtig. Erstens wird nicht nur eng die jeweils porträtierte Vorlage beleuchtet, sondern im Unterkapitel «Wirkung» stets auch in die Zukunft geblickt, wo spätere verwandte Abstimmungen kurz erwähnt und in den Kontext gesetzt werden. Zweitens zeigt das Autorenteam auf, dass die direkte Demokratie im Allgemeinen und einzelne Abstimmungsfragen im Konkreten überhaupt spürbare Wirkung entfalten, das Land und Leben gestalten, ja Identität stiften. In Zeiten des erstarkenden Autoritarismus in wichtiges Statement! Und schliesslich ist das mit Abstimmungsplakaten und Karten mit den Kantonsresultaten attraktiv gestaltete Buch schlicht eine schöne Gelegenheit, in der Schweizer Demokratiegeschichte zu blättern und vergangene Abstimmungssonntage Revue passieren zu lassen.
 Marcel Hänggi: Weil es Recht ist – Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung (Rotpunkt)
Marcel Hänggi: Weil es Recht ist – Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung (Rotpunkt)
In seinem Buch «Weil es Recht ist» stellt Marcel Hänggi, Journalist, Historiker und Initiant der «Gletscherinitiative», die Frage, ob die Schweizer Bundesverfassung für das Zeitalter der «multiplen Umweltkrisen» – Klimaerwärmung und Biodiversitätsschwund – gerüstet ist oder ob sie allenfalls revidiert werden müsste. Im ersten Teil des Buchs wird die geltende Bundesverfassung von 1999 unter die ökologische Lupe genommen. Ein Thema ist natürlich der Umweltschutzartikel 74 BV sowie die folgenden Bestimmungen über Raumplanung, Zweitwohnungen und Wasser. Doch Hänggi nimmt ebenso allgemeinere Verfassungsgrundsätze in den Blick wie das Nachhaltigkeits- und das Verursacherprinzip. Auch die Grundrechte (und -pflichten), die kollidierende Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit werden erörtert.
Hänggis Fazit, was die Bundesverfassung nun tauge, ist ambivalent. Sie gebe durchaus Handlungsrichtlinien vor, die so richtig wie unerfüllt seien: «Rücksicht auf künftige Generationen, das Vorsorgeprinzip, der Vorrang des Ökologischen vor dem Ökonomischen, die politisch so unbeliebte Suffizienz, Grenzen – die Bundesverfassung enthält das alles.» Auf dem Papier. Im gesetzgeberischen Alltag und später beim Vollzug der Erlasse würden die genannten Maximen aber viel zu oft torpediert. Der Autor schlägt daher viele konkrete (Verfassungs-)Änderungen vor, um ihnen Nachachtung zu verschaffen.
Die präsentierten Lösungen (beispielsweise Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit oder eine «Eigentumspolitik») seien nicht unbedingt mehrheitsfähig, könnten aber doch auf mehrheitsfähigen Grundprinzipien aufbauen. Überdies sind viele Verbesserungen weder neu noch «originell», sondern wurden schon andernorts vorgeschlagen, andere wiederum existieren bereits in den Kantonen (etwa das «Recht auf ein Leben in einer gesunden Umwelt» in Genf) oder im Ausland. Doch müssten wir nicht nur die Umwelt vor den Folgen unserer Tätigkeiten schützen. Auch wir müssten uns selbst und unsere Institutionen vor der Umwelt schützen, wenn diese aus den Fugen gerät. «Die Umweltkrisen der Gegenwart und der Zukunft zerstören nicht nur Ökosysteme. Sie gefährden auch die Demokratie.»
In Teil II untersucht der Autor daher, wie die demokratische Gesellschaft und ihre Institutionen gegenüber den Krisen resilient, also widerstandsfähig gemacht werden können. In diesem Teil werden denn nebst umweltspezifischen Proklamationen (Einhaltung der planetaren Grenzen, Regeneration beschädigter Ökosysteme) insbesondere auch wirtschafts- und staatspolitische Veränderungen angeregt. Themen sind hier etwa die Technikfolgenabschätzung, Desinformation, Deliberation (repräsentative Bürgerräte) oder der vor einiger Zeit in diesem Blog vorgeschlagene Demokratieförderungs-Artikel. Fragwürdig sind einzig die Forderungen, «Falschaussagen in politischen Debatten» zu regulieren, sowie die Verfassungsgerichtsbarkeit auf nationaler Ebene: Es ist falsch zu suggerieren, deren Absenz sei eine helvetische Anomalie. Als Journalist und Lehrer (und Nicht-Jurist) versteht es Hänggi sehr gut, die komplexe Materie anschaulich und spannend darzustellen und trotz aller Ernsthaftig- und Dringlichkeit den Optimismus nicht zu verlieren.
 Hermann K. Heussner, Arne Pautsch, Frank Rehmet & Lukas Kiepe (Hrsg.): Mehr direkte Demokratie wagen – Volksentscheid und Bürgerentscheid: Geschichte – Praxis – Vorschläge (4. Auflage) (Lau)
Hermann K. Heussner, Arne Pautsch, Frank Rehmet & Lukas Kiepe (Hrsg.): Mehr direkte Demokratie wagen – Volksentscheid und Bürgerentscheid: Geschichte – Praxis – Vorschläge (4. Auflage) (Lau)
«Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt.» Seit 75 Jahren bekennt sich das deutsche Grundgesetz nicht nur zur Volkssouveränität, sondern, mittels Durchführung von Volksabstimmungen, eigentlich gar zur direkten Demokratie. Bekanntlich hat in diesem Zeitraum in Deutschland aber keine einzige bundesweite Abstimmung je stattgefunden. Der Verein Mehr Demokratie e. V. möchte dies ändern und setzt sich seit 1988 für mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene ein. Dazu unterstützt er Bürger- und Volksbegehren, begleitet Reformvorhaben, führt Kampagnen.
Nun ist aus dem Umfeld des Vereins eine überarbeitete Neuauflage des Sammelbands «Mehr direkte Demokratie wagen» erschienen, für den 42 Autoren (vornehmlich Historiker, Juristen, Politologinnen, Ökonomen) 33 Beiträge beigesteuert haben. Das Themenspektrum ist sehr breit und reicht von theoretischen Grundlagen über Rechtsgeschichte («Schlechte Weimarer Erfahrungen?») bis hin zu Schlaglichtern auf ausländische «Vorbilder» (Schweiz, USA, Italien und Irland). 11 weitere Kapitel beleuchten die Ausgestaltung, Praxis und Erfahrungen konkreter Volksbegehren in einigen deutschen Ländern sowie die kommunale direkte Demokratie. Ein Dutzend Beiträge widmen sich Einzelfragen und runden den spannenden, durchwegs gut lesbaren Sammelband ab.
Besonders hervorzuheben sind drei Aufsätze: Achim Wölfel stellt das «direktdemokratische Schwergewicht» Irland vor, das gerade in den letzten Jahren mit überraschenden Verfassungsnovellen international für Aufsehen gesorgt hat. Bemerkenswert ist hier einerseits das innovative und befriedende Zusammenspiel zwischen deliberativer (gelosten Bürgerräten) und direkter Demokratie. Spannend ist andererseits die von Regierung und Parlament unabhängige «Referendum Commission», die die Bevölkerung vor den Urnengängen umfassend und neutral informiert.
Über den Brexit ist schon (viel zu) viel geschrieben worden; Camerons Plebiszit und dessen Abstimmungsresultat müssen bis heute als Mahnmal gegen Volksentscheide herhalten. Doch Wolf J. Schünemann zeigt auf, dass die anhaltende Pauschalkritik an diesem Referendumsinstrument überschiessend ist. Aufgrund der britischen Tradition der Parlamentssouveränität wäre ein anderes Abstimmungsdesign kaum denkbar gewesen: «Die Gründe für den Sieg des Leave-Lagers sind nicht in der Wahl des Referendumsinstruments oder in seiner Durchführung zu suchen. Vielmehr hat eine tiefe politische Spaltung mit Blick auf das europäische Integrationsprojekt das Land seit langer Zeit geprägt.»
Fabian Wittreck und Arne Pautsch umreissen das Verhältnis der deutschen Direktdemokratie zur (Verfassungs-)Gerichtsbarkeit. Grösster Stolperstein ist das «Finanztabu», das Volksbegehren verbietet, finanzwirksame Forderungen zu stellen. Äusserst bedenklich ist darüber hinaus die Tendenz diverser Landesverfassungsgerichte, selbst Volksbegehren zu kassieren, die mittels Verfassungsreform die Demokratie ausbauen möchten (Senkung der Quoren, Verlängerung von Fristen, Ausdehnung der inhaltlichen Zulässigkeit).
 René Lüchinger, Peter Schürmann & Gerhard Schwarz: Ringen um Freiheit – Liberalismus in der Schweiz (NZZ Libro)
René Lüchinger, Peter Schürmann & Gerhard Schwarz: Ringen um Freiheit – Liberalismus in der Schweiz (NZZ Libro)
Der Einfluss des Liberalismus auf die schweizerische Demokratie kann kaum überschätzt werden. René Lüchinger, Peter Schürmann und Gerhard Schwarz legen nun eine Geschichte des schweizerischen Liberalismus vor, die diese Symbiose eindrücklich aufzeigt, und zwar auf eine Art, die einem breiten Publikum verständlich ist.
Zur Strukturierung wählen die Autoren die Biografien einflussreicher Personen, was deren Rollen zuweilen überzeichnet, aber das Werk sicherlich zugänglich macht. Was sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht, sind die inneren Konflikte und Richtungskämpfe, die sich immer wieder entspannen. Etwa zwischen Alfred Escher, der den privaten Eisenbahnbau durchsetzte, und seinem Berner Rivalen Jakob Stämpfli, der für eine Verstaatlichung eintrat.
Aber auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, als sich Teile des (Jung-)Freisinns der Frontenbewegung zuwandten, wogegen sich Leute wie NZZ-Chefredaktor Willy Bretscher leidenschaftlich wehrten. Den einen schweizerischen Liberalismus gibt es eben nicht und kann es auch nicht geben, wenn er sich als Volksbewegung versteht, was heute freilich immer weniger der Fall ist. Im Schlussteil des Buches skizziert Gerhard Schwarz in einem Ausblick, wie ein erfolgreicher Liberalismus im 21. Jahrhundert aussehen könnte. Klar dürfte sein: Er wird auch in Zukunft umstritten bleiben.
 Oliver Zimmer: Prediger der Wahrheit – Von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft (Claudius)
Oliver Zimmer: Prediger der Wahrheit – Von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft (Claudius)
Ob in der Klimapolitik, bei der Migration oder in der Schweiz beim Rahmenabkommen mit der EU: Bei vielen politischen Konflikten der Gegenwart geht es zentral um die Frage, wer am Ende entscheidet – die Bürger, ihre Vertreter auf nationaler Ebene oder Technokraten in internationalen Institutionen? Dabei gibt es über die demokratische Welt hinweg einen starken Druck, die Macht weg vom Bürger zu verschieben.
Die Idee dahinter, dass «Experten» letztlich am besten wissen, was gut und richtig ist, führt Oliver Zimmer auf die Reformation zurück. In seinem Essay «Prediger der Wahrheit» zeigt der Historiker auf, wie die Reformation als Bewegung begann, die den einzelnen Gläubigen ins Zentrum stellte und ihm die Aufgabe übertrug, die heilige Schrift zu verstehen und zu interpretieren – ohne Vermittlung durch berufene religiöse Autoritäten. Doch bald nach ihrem Erfolg bekamen die Reformatoren kalte Füsse. Martin Luther wurde insbesondere durch die deutschen Bauernaufstände (die sich direkt auf die Ideen der Reformation beriefen) aufgeschreckt und änderte seinen Kurs scharf. Fortan galt nicht mehr «Sola Scriptura»; die Gläubigen wurden wieder unter die Ägide der geistlichen Elite gestellt.
Zimmer zieht die Parallelen zu heute, wo relevante Fragen zunehmend demokratischen Entscheiden entzogen und stattdessen Gerichten oder überstaatlichen Gremien übertragen werden – bevorzugt überstaatlichen Gerichten. Bei der zunehmenden Verrechtlichung der Politik stellt Zimmer eine Symbiose von traditioneller und moderner Epistokratie fest. Letztere greift gerne auf «moralische Master-Narrative» zurück, wie Zimmer sie nennt. Diese ziehen den Rahmen der Meinungsfreiheit zwar nicht rechtlich, aber faktisch in der öffentlichen Debatte zunehmend enger – im Sinne einer Elite der «Wissenden». Zimmers Analyse ist ebenso fundiert wie provokativ. Wem die demokratische Mitsprache ein Anliegen ist, muss von den epistokratischen Tendenzen beunruhigt sein.







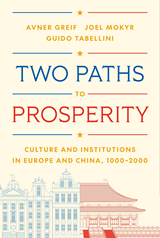






















 Paul Widmer: Die Schweiz ist anders – oder sie ist keine Schweiz mehr (
Paul Widmer: Die Schweiz ist anders – oder sie ist keine Schweiz mehr ( Christopher Clark: Frühling der Revolution. Europa 1848/49 und der Kampf für eine neue Welt. München (
Christopher Clark: Frühling der Revolution. Europa 1848/49 und der Kampf für eine neue Welt. München (

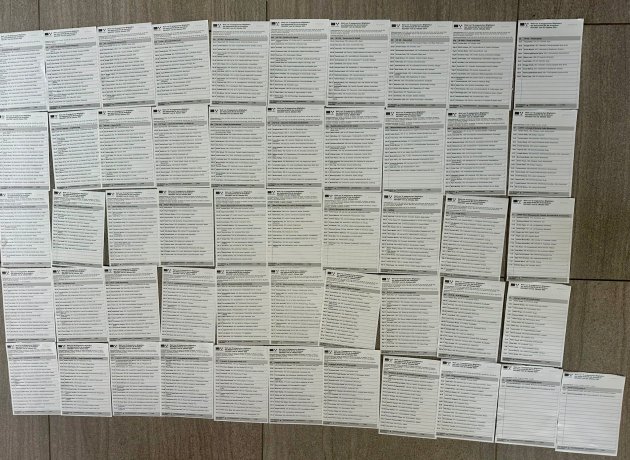
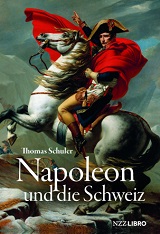
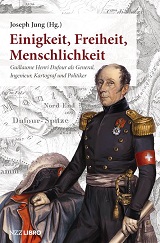






















Recent Comments