Die Einführung und Erweiterung des Ausländerstimmrechts stösst in den Kantonen auf Ablehnung. Wenig erstaunlich, zeigen sich die portierten Initiativen doch zumeist ziemlich undifferenziert.
In diversen Kantonen hat sich das aktive oder passive Wahl- und Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer (Ausländerstimmrecht) auf kantonaler oder zumindest kommunaler Ebene etabliert (siehe: Ausländerstimmrecht: ein kantonales Panoptikum). Dennoch harzt die weitere Verbreitung des Ansinnens: Obschon beispielsweise der Kanton Waadt seit zehn Jahren das kommunale Ausländerstimmrecht kennt, lehnten es die Stimmbürger 2011 mit 69 Prozent deutlich ab, dieses auf die kantonale Ebene auszuweiten.
In der Deutschschweiz scheiterten bisher sogar alle kantonalen Initiativen, welche das Ausländerstimmrecht auf die eine oder andere Art einführen wollten: So 2010 Bern (72 % Nein), Basel-Stadt (81 % bzw. 61 % Nein beim Gegenvorschlag) und Glarus (Landsgemeinde: «wuchtig verworfen») sowie 2011 in Luzern (84 % Nein). Kürzlich reihte sich auch Zürich (75 % Nein) in diese ruhmlose Serie ein.
Und gerne geht vergessen, dass in Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Freiburg und Graubünden wohl nur deshalb das (fakultative) kommunale Ausländerstimmrecht gilt, weil dieses jeweils mit einer Totalrevision der Verfassung einherging. Explizit an der Urne eingeführt oder bestätigt, wurde es nämlich – abgesehen von Genf und Neuenburg – noch nirgends.
Morgen Montag debattiert nun der Schaffhauser Kantonsrat über die wohl offensivste Ausländerstimmrecht-Initiative, die je in der Schweiz lanciert wurde: Nach fünf Jahren Aufenthalt sollen alle Ausländer zwingend sowohl das kommunale, wie auch kantonale Stimmrecht erhalten. Die Initianten der Alternativen Liste (AL) Schaffhausen geben denn auch offen zu, dass sie sich «keine Illusionen» machen: «Wir werden mit unserer Initiative an der Urne noch keine Mehrheit gewinnen.» Es erscheine ihnen aber umso wichtiger, «das Thema endlich aufs politische Parkett zu bringen und eine breite politische Debatte dazu in Gang zu setzen.»
Diesem Anspruch wollen wir uns gerne anschliessen. Im Rahmen der vielen gescheiterten Initiativen wurde oftmals über die Karenzfrist debattiert: wie lange also ausländische Staatsbürger bereits in der Schweiz oder im jeweiligen Kanton niedergelassen sein müssen, um das Ausländerstimmrecht erlangen zu können. Doch dieses zeitliche Kriterium ist nur eines unter vielen zu etwaig berücksichtigenden, zumal eines der nebensächlicheren.
Viel wichtiger wäre, über andere Erfordernisse und Einschränkungen zu diskutieren, welche (womöglich) an das Ausländerstimmrecht zu stellen sind.[1] Decem conditiones sine quibus non:
1. Fakultatives Stimmrecht (keine Stimmpflicht)
Niemand soll – unter Buss- oder Strafandrohungen – gezwungen werden, an der Demokratie teilzuhaben. Für Ausländer, die der Amtssprache gegebenenfalls nicht mächtig sind, gilt dies in erhöhtem Masse. Das Abstimmen und Wählen muss, auch und gerade für sie, freiwillig bleiben. Das Ausländerstimmrecht ist daher mit der Stimmpflicht unter keinen Umständen vereinbar, welche hierzulande jedoch nur noch der Kanton Schaffhausen kennt. Die Initiative der AL ignoriert diese Unvereinbarkeit leider.
2. Sprachnachweis
Die Theorieprüfung zum Führerschein kann nicht nur auf Deutsch oder Französisch, sondern auch auf Portugiesisch, Englisch oder Arabisch absolviert werden. Die demokratische Deliberation indes, speziell im Vorfeld von Volksabstimmungen und -wahlen, ganz allgemein aber auch im medialen, sozialen, schulischen und kulturellen Raum, findet vornehmlich in den Landessprachen statt. Wer an der Demokratie teilnimmt, soll sich Gehör verschaffen können, gleichsam aber auch verstehen, was andere Partizipanten und Kontrahenten ihrerseits für Argumente hervorbringen.
Das sich gegenseitige Verstehen bedingt grundlegende Kenntnisse der lokalen Amtssprache, ansonsten eine Segregation drohen kann. Die Garantie der politischen Rechte schützt denn auch «die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe», wofür Sprachkenntnisse eine notwendige Bedingung darstellen.
Konkret könnte der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse analog zur beschleunigten Erteilung der Niederlassungsbewilligung eingefordert werden. Jene kann schliesslich bereits nach fünf (statt zehn) Jahren erteilt werden, «wenn die betroffene Person über gute Kenntnisse einer Landessprache verfügt». Und diese Bestätigung könnte selbstverständlich für ein zukünftiges Einbürgerungsverfahren angerechnet werden und somit integrationsfördernd wirken.
Portugal beispielsweise geht in diese Richtung: Das dortige Ausländerstimmrecht gilt nur für Angehörige portugiesischsprachiger Staaten wie etwa Brasilien.
3. Opting-In (und Opting-Out)
Auslandschweizer erhalten das Schweizer Stimmrecht nicht automatisch; sie müssen es auf der zuständigen Schweizer Vertretung zuerst beantragen. Es sollen dabei nicht Personen ins Stimmregister aufgenommen werden, welche sowieso kein Interesse an der Ausübung der politischen Rechten bekunden. Sinnlose Porti, Druckmaterial und Versand können so gespart werden.
Ein unbürokratisches Opting-In fürs Ausländerstimmrecht ist daher angezeigt, wie es beispielsweise der Kanton Appenzell Ausserrhoden vorsieht. Zuletzt sollte natürlich auch beantragt werden können, sich wieder aus dem Stimmregister streichen zu lassen. Dieses Opting-Out schliesslich sollte jedoch allen Stimmberechtigten offen stehen, also auch den Schweizer Bürgern.
4. Reversibilität (Übungsabbruch ermöglichen)
Direktdemokratische Einbahnstrassen schlägt der Verfassungsgeber nur ungern ein. Sprich: Das Stimmvolk ist eher bereit ein Wagnis einzugehen, wenn es den Versuch gegebenenfalls auch wieder abbrechen könnte. Diese Zurückhaltung ist nachvollziehbar und zeugt grundsätzlich von einer gewissen Stabilität. Die Einführung des Ausländerstimmrechts wäre denn seit der Gründung des Bundesstaats nebst der Einführung des Frauenstimmrechts immerhin die wohl grösste Einbahnstrasse, in welche eingeschwenkt wurde. Einmal eingeführt, kann der damalige Verfassungsgeber diese Novelle nicht wieder aus der Verfassung streichen – die Stimmbürgerschaft wäre schliesslich mit der damaligen nicht mehr kongruent. Das Recht auf Abrogation wird zwar nicht verunmöglicht, aber erschwert.
Gefordert sei daher eine «U-Turn»-Möglichkeit statt der «Einbahnstrasse». Verfassungsrechtlich könnte diese Sicherung auf mannigfaltige Arten eingebettet werden:
- Entweder als Grandfathering-Übergangsbestimmung,
- als Klausel, die – mit einem «Verfalldatum» von vielleicht 10 Jahren versehen – auch bloss temporär installiert werden könnte oder
- als automatisch-abrogatives Referendum: nach einer gewissen Frist müssten die Schweizer Bürger das Ausländerstimmrecht bestätigen.
Das Erfordernis der Reversibilität erscheint schliesslich umso sinnvoller, je höher die Staatsebene, welche das Ausländerstimmrecht einzuführen gedenkt: Auf Stufe Gemeinde ist sie von untergeordneter Bedeutung, zumal ein Übungsabbruch allenfalls auch auf kantonaler Ebene erwirkt werden könnte. Auf höchster – der nationalen – Ebene erschiene die Umkehrmöglichkeit indessen essenziell.
5. Eingeschränkter Geltungsbereich (materiell oder der Normstufe)
Gerade auf nationaler Ebene müsste der Geltungsbereich des Ausländerstimmrechts für jene Verfassungsartikel und Vorlagen wegbedungen werden, welche an das Schweizer Bürgerrecht geknüpft sind. Es würde ansonsten kaum goutiert, wenn die ausländische, nicht-dienstpflichtige Bevölkerung mitbestimmen würde, ob und wie «jeder Schweizer verpflichtet [ist], Militärdienst zu leisten». Analoges gilt mitunter für Bestimmungen über den Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung, die Bürgerrechte, die Wählbarkeit für den Bundesrat usw.
Der Eingangs erwähnte, gescheiterte Glarner Memorialsantrag zur Einführung des Ausländerstimmrechts sah denn sinnvollerweise für Gemeindeversammlungen immerhin vor: «Einbürgerungsentscheide bleiben Schweizer Bürgern vorbehalten.» Ansonsten könnten sich Ausländer gewissermassen selbst einbürgern.
Der Geltungsbereich des Ausländerstimmrechts könnte also durchaus materiell eingeschränkt werden. Eine Lex specialis für Verfassungsrevisionen könnte vorsehen, dass nur Schweizer Stimmbürger ermächtigt sind, Änderungen vorzunehmen, welche die politischen Rechte oder andere Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Bürgerrecht tangieren. Andererseits können sich bei dieser Einschränkung durchaus auch Abgrenzungsprobleme ergeben.
Vielleicht just aus diesem Grund kennt der «Vorzeigekanton» Jura keine materielle, sondern eine weitergehende (und erstaunlicherweise kaum je erwähnte) formelle Einschränkung: Die Ausländerinnen und Ausländer «ne participent pas au scrutin touchant la matière constitutionnelle». Das Ausländerstimmrecht ruht also bei Änderungen der jurassischen Kantonsverfassung (sowie anderen Erlassen von Verfassungsrang, wie etwa Konkordaten), wohingegen die Migranten bei fakultativen Referenden, zumeist Gesetzen und Finanzbeschlüssen, mitbestimmen dürfen.
6. Subsidiarität (tangierte Staatsebene entscheidet autonom)
Grundsätzlich sind subsidiäre Modelle den obligatorischen vorzuziehen. Der Kanton soll es seinen politischen Gemeinden (und anderen untergeordneten Körperschaften wie Bezirke, Kreise, Schul- und Kirchgemeinden, Zweckverbände, Korporationen usw.) überlassen, ob sie das Ausländerstimmrecht für ihre Angelegenheiten einführen wollen. Gleiches gilt selbstverstänldich für den Bund, der den Kantonen das Ausländerstimmrecht nicht aufzwingen soll; jede Staatsebene soll autonom über diese Frage befinden.
7. Singularität («One man, one vote»)
«Niemand darf die politischen Rechte in mehr als einem Kanton ausüben» schreibt die Bundesverfassung den Schweizern völlig unbestritten vor. Analoges sollte für alle Staatsebenen gelten: Niemand soll die politischen Rechte gleichzeitig in mehr als einer Gebietskörperschaft der gleichen Stufe ausüben. Die Genfer Verfassung verlangt daher folgerichtig, dass «niemand in mehr als einer Gemeinde oder einem Bezirke stimmberechtigt [ist]». Diese Maxime sollte indessen nicht an der Schweizer Grenze halt machen, sondern hat globale Gültigkeit.
Ein etwaiges Mehrfachstimmrecht ergibt sich als Ausfluss des Instituts Doppel- und Mehrfachbürgerschaft. Doch im Sinne des Axioms «One man, one vote» sind Doppelstimmrechte auf gleicher Staatsebene auszuschliessen. Ähnlich, wie Schweizer Doppelbürger nicht etwa in beiden Staaten gleichzeitig militärdienstpflichtig sind.
8. Territorialität und Reziprozität (kein Stimmrecht für Auslandschweizer und Gegenseitigkeit)
Die wohl naheliegendste Begründung für das Ausländerstimmrecht ist, dass die ausländischen Mitbürger ebenso wie die Schweizer hier leben, arbeiten, konsumieren und Steuern entrichten – das Argument der Territorialität. Doch diese sollte kohärenterweise und im Umkehrschluss auch für die Auslandschweizer gelten: Wer nicht hier lebt, soll hier auch nicht mitbestimmen dürfen – weder bei nationalen, kantonalen noch kommunalen Angelegenheiten.
Das Stimmrecht der Auslandschweizer sei daher konsequenterweise aufzuheben. Auf nationaler Ebene sei ihnen höchstens dann das Stimmrecht zu gewähren (immerhin steht ihnen das jederzeitige Recht zu, «in die Schweiz einzureisen»), wenn sie nicht bereits im Wohnsitzstaat auf höchster Stufe politisch partizipieren dürfen. Ansonsten würde das Singularitätsgebot verletzt.
Die Frage bleibt, ob den Auslandschweizern in ihrem Aufenthaltsstaat überhaupt das lokale Wahlrecht, zum Beispiel in ihrer Kommune, eingeräumt wird. Durch die Bedingung der Reziprozität könnte beispielsweise die Schweiz nur jenen Ausländern das (kommunale) Stimmrecht zugestehen, deren Heimatland es den dortigen Auslandschweizern ebenfalls einräumt. Spanien (mit den skandinavischen Ländern) und Portugal (mit Brasilien) unterhalten beispielsweise jeweils solche gegenseitigen Übereinkommen.
9. Ausschluss des passiven Wahlrechts
Dass an das passive Wahlrecht – gegenüber dem Elektorat – erhöhte Anforderungen gestellt werden können, ist unbestritten, man denke nur an die verschiedenen Unvereinbarkeitsregelungen. Oder an die US-amerikanische Verfassung: «No person except a natural born Citizen […] shall be eligible to the Office of President.»
Jura und Neuenburg, die beiden Vorreiterkantone in Sachen Ausländerstimmrecht, kennen denn auf kantonaler Ebene auch nur das aktive Wahlrecht. Der Jura beschränkt sogar die Wählbarkeit in den Gemeinden auf die Parlamente. Ähnliches gilt für die Wahl der Neuenburger Ständeräte: Zwar werden sie auch durch die ausländischen Stimmberechtigten gewählt, ins Stöckli einziehen dürfen indes nur Kandidaten mit Schweizer Pass. (Das Bundesrecht wiederum verbietet a priori «ausländische Ständeräte» nicht!)
10. Karenzfrist und Aufenthaltsstatus
Die aktuellen Regelungen in den Kantonen AR, JU und VD sehen immerhin zehn Jahre Aufenthalt in der Schweiz vor (in GE deren acht), bevor das Ausländerstimmrecht erteilt werden darf. Zusätzlich müssen oftmals Karenzfristen innerhalb des Kantons und der Gemeinde abgewartet werden.
Ist jedoch ein Strauss an vorne aufgeführten Einschränkungen erfüllt, so brauchen keine übermässig hohen Hürden hinsichtlich der Aufenthaltsdauer mehr gestellt zu werden, bürgen doch jene Erfordernisse, wie beispielsweise der Sprachnachweis für eine qualitativ weitaus bessere Grundlage der Integration als die reine Dauer des bisherigen Aufenthalts.
Eine gewisse Wartedauer für Ankömmlinge ist dennoch anzeigt, bevor sie das Ausländerstimmrechts erlangen können sollen. Zum einen, weil die Kantone auch für Schweizer vorsehen dürfen, dass «Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten erst nach einer Wartefrist von höchstens drei Monaten nach der Niederlassung ausüben dürfen». Und andererseits, weil selbst Immigranten aus dem gleichen Sprachraum vorab das Kennenlernen der hiesigen Kultur, Tradition, Usanzen, Gesetze, Werte und Politik zugestanden werden soll.
Nichtsdestotrotz erscheint das Anknüpfen an eine Niederlassungsbewilligung zielführender als das blosse Abwarten einer Karenzfrist von fünf oder zehn Jahren. Denn jene Bewilligung wird just nach Aufenthalt von fünf bis zehn Jahren erteilt, jedoch abhängig davon, ob «die betroffene Person über gute Kenntnisse einer Landessprache verfügt» und erfolgreich integriert ist. Gerade qualitative Kriterien also, die weitaus besser geeignet sind, um das Ausländerstimmrecht zu erteilen.
Fazit
Werden diese zehn Kriterien und Einschränkungen – oder zumindest ein Teil davon – beim Erarbeiten von Vorlagen zur Einführung des Ausländerstimmrechts vermehrt beachtet, so könnte dem Ansinnen dereinst wieder mehr Erfolg beschieden werden.
Denn gerade institutionelle Reformen haben es hierzulande besonders schwer; die Weiterentwicklung der direkten Demokratie will Weile haben. Ein behutsameres, differenzierteres Vorgehen in diesem Sinne sei daher zukünftigen Initianten nahegelegt.
[1] Vgl. zum Ausländerstimmrecht: Beat Rudin (2002): Ausländische Staatsangehörige in der Politik – Möglichkeiten und Grenzen politischer Betätigung, in: Peter Uebersax et al. (Hrsg.), Ausländerrecht – Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht, Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der Schweiz; Tiziana Locati Harzenmoser (2003): Warum ein Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer? – Plädoyer für ein kantonales und kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer, in: Patricia M. Schiess Rüttimann (Hrsg.) (2003): Schweizerisches Ausländerrecht in Bewegung?, S. 165 ff.; David R. Wenger (2004): Das Ausländerstimmrecht in der Schweiz und im europäischen Ausland – ein kommentierter Rechtsvergleich, AJP10/2004, 1186 ff.; Martin Schaub (2010): Ausländerstimmrecht, Glarus 2010; Martina Caroni (2013): Herausforderung Demokratie, ZSR 2013 II, 5.










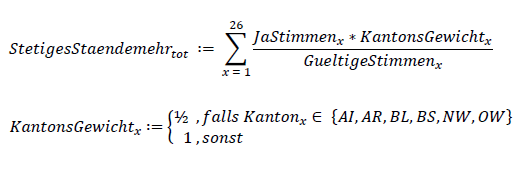








Recent Comments