Der belgische Historiker David Van Reybrouck propagiert das Los als Mittel gegen die Demokratiemüdigkeit. Das radikale Plädoyer für Vertrauen in die Bürger ist ein spannender Ansatz, bleibt jedoch auf halbem Weg stecken.
Die Beteiligung an Wahlen sinkt, das Vertrauen in demokratische Institutionen ebenfalls, radikale politische Kräfte erschüttern die Politik, die Debatte im Zeitalter der Mediendemokratie wird immer schneller, dreckiger und oberflächlicher. Die Diagnose, die der belgische Historiker David Van Reybrouck in seinem Buch «Gegen Wahlen» stellt, ist nicht neu. Schon zur Jahrtausendwende prägte Colin Crouch den Begriff «Postdemokratie», und kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein Leitartikel Sorgen über die Zukunft der Demokratie zum Ausdruck bringt.
 Was Van Reybrouck von den meisten Besorgten unterscheidet, ist seine Lösung. Das grundlegende Problem, schreibt er, sei das elektoral-repräsentative System, das sich in allen demokratischen Staaten etabliert hat. Dieses sei nämlich gar nicht demokratisch, sondern aristokratisch. Eine wahre Demokratie besetze Posten nicht durch Wahlen – sondern durch das Los.
Was Van Reybrouck von den meisten Besorgten unterscheidet, ist seine Lösung. Das grundlegende Problem, schreibt er, sei das elektoral-repräsentative System, das sich in allen demokratischen Staaten etabliert hat. Dieses sei nämlich gar nicht demokratisch, sondern aristokratisch. Eine wahre Demokratie besetze Posten nicht durch Wahlen – sondern durch das Los.
Um seine These zu untermauern, geht Van Reybrouck zurück zu den Anfängen der Demokratie, ins antike Athen. Dort wurden tatsächlich viele wichtige Stellen im Staat unter den Bürgen ausgelost. Nur bestimmte Positionen, die spezifische Fähigkeiten erforderten (etwa die des Kriegsherrn), wurden durch Wahlen besetzt. Dieses System garantierte laut Van Reybrouck, dass im Grunde keine Unterschiede zwischen Regierten und Politikern bestanden.
Ausgeloster Landammann
Der Historiker nennt weitere historische Beispiele, in denen das Losverfahren zum Einsatz kam, so etwa in Venedig und Florenz in der frühen Neuzeit. Dass die aristokratischen Stadtstaaten als Beispiele für ein angeblich besonders demokratisches Verfahren herhalten müssen, ist eine Ironie in Van Reybroucks Argumentation. Er hat aber recht, wenn er darauf hinweist, dass das Los als Auswahlmechanismus in der Geschichte weiter verbreitet ist, als uns heute bewusst ist.
Auch in der Schweiz fand das Losverfahren Anwendung, und zwar auch in Staaten, die im Gegensatz zu Venedig und Florenz wenigstens dem Grundsatz nach demokratisch organisiert waren. Es ist heute kaum noch bekannt, dass eine Zeitlang einige Landsgemeindeorte sowie Graubünden (ebenso übrigens das aristokratische Bern) wichtige Ämter per Los vergaben. Sie taten dies indes nicht aus demokratischer Überzeugung heraus, sondern, um der weitverbreiteten und teilweise massiven Bestechung bei Wahlen einen Riegel zu schieben. Kandidaten für wichtige Stellen überboten sich darin, massenhaft Stimmen zu kaufen.[1] Dieses Übel zu beenden, war auch im Interesse der reichen Oberschicht, denn einige ihrer Angehörigen trieben den Bestechungswettkampf so weit, dass sie sich selber völlig ruinierten.
Weil weder Verbote noch Eidesbekenntnisse die Korruption aus der Welt zu schaffen vermochten, sah man als einzigen Ausweg die Auslosung der Ämter, um den Anreiz für Bestechungen zu unterbinden. Dabei wurden zunächst Wahlen und Auslosung kombiniert: In Glarus etwa wurde ab 1640 der Regierungschef (Landammann) aus sechs gewählten Kandidaten ausgelost. Weil auch in diesem System Unregelmässigkeiten allzu regelmässig vorkamen, gingen die Glarner 1791 zum reinen Losverfahren über: ein Teil der Ämter (ausgenommen war das Landammannamt und einige andere Positionen) wurde unter sämtlichen Bürgern des Landes ausgelost. Dies führte dazu, dass zuweilen Leute zu einem Amt kamen, die dafür völlig ungeeignet waren (z.B. weil sie nicht lesen konnten). In vielen Fällen verkauften die glücklichen Gewinner ihr Amt daher einfach an den Meistbietenden, womit man wieder dort war, wo man angefangen hatte: beim Ämterkauf.
Dass das Losverfahren nicht aus demokratischen Überlegungen heraus eingeführt wurde, zeigt sich schon daran, dass sämtliche Kantone das Verfahren wieder abschafften, sobald sie das Gefühl hatten, das Problem der Korruption einigermassen im Griff zu haben.
Das Los wurde zwar von namhaften Denkern wie Aristoteles oder Rousseau befürwortet. In der breiten Bevölkerung fand es hingegen wenig Anklang. Die demokratischen Bestrebungen des 19. Jahrhunderts forderten die Ausweitung des Wahlrechts, das Ende der Pressezensur, direktdemokratische Rechte, später proportionale Wahlverfahren – aber nicht die Auslosung von politischen Ämtern. Man kann das Losverfahren als gerechter, effizienter oder besser bezeichnen. Dass es demokratischer sein soll, ist hingegen eine absurde Behauptung. Schon der Begriff Demokratie steht in Konflikt mit der Auslosung von Ämtern. Wie soll das «Volk» «herrschen» können, wenn die Entscheidungsgewalt in den Händen einer kleinen Gruppe von Glücklichen liegt, die das grosse Los gezogen haben?[2] Es zeugt auch nicht gerade von grossem Vertrauen in den mündigen Bürger, wenn man glaubt, ihm einen Gefallen zu machen, indem man ihm ein Recht entzieht.
Der Sozialismus glaubte, eine gerechte Wirtschaftsordnung zu schaffen, indem er den Menschen die Wahlfreiheit wegnahm und wirtschaftliche Transaktionen an eine zentrale Planungsbehörde delegierte. Diese Logik übernimmt, wer glaubt, eine gerechtere Demokratie zu schaffen, indem er den Menschen die Wahlfreiheit wegnimmt.
Erwachsene statt Stimmvieh
Dabei ist die Grundidee Van Reybroucks eigentlich überzeugend: Zwischen Bürgern und Politikern sollte es keine Unterschiede geben. Den Menschen sollte zugetraut werden, mitzureden, Ideen einzubringen und mitzuentscheiden. Sein Ideal ist die deliberative Demokratie, in der die Bürger (und eben nicht nur die Politiker) durch öffentliche Beratung und Diskussion zu (idealerweise) gerechten und sinnvollen Lösungen kommen. Zu Recht weist Van Reybrouck darauf hin, dass es schon vielversprechende Ansätze gab, zufällig ausgeloste Bürger in den politischen Prozess einzubeziehen. Meist geschah dies auf lokaler Ebene (etwa in vielen Gemeinden in der Toskana), aber nicht nur. So erarbeitete in Irland eine Gruppe von 66 ausgelosten Bürgern und 33 Politikern eine Änderung der Verfassung. Es ging um insgesamt acht Themenbereiche. Der umstrittenste Vorschlag, die Einführung der Homo-Ehe, wurde 2015 in einer Volksabstimmung von 62 Prozent der Stimmenden angenommen.
«Behandelt man den mündigen Bürger wie Stimmvieh, so wird er sich wie Stimmvieh verhalten, behandelt man ihn aber wie einen Erwachsenen, so wird er sich wie ein Erwachsener verhalten.»[3] Der Satz von Van Reybrouck ist der beste des ganzen Buches. Umso irritierender ist seine tiefe Ablehnung der direkten Demokratie. Die Bürger sollen zwar mehr mitreden, aber nur wenn sie ausgelost werden und in einer Gruppe unter Anleitung von Experten diskutieren. Die Mitwirkung einer breiteren Öffentlichkeit dagegen ist offenbar nicht erwünscht. Denn bei Referenden «bittet man alle, über ein Thema abzustimmen, mit dem sich meist nur wenige auskennen». «Sehr oft» komme deshalb das «Bauchgefühl» der Stimmenden zum Ausdruck, erklärt uns der Historiker, ohne dafür Belege anzuführen.[4] Damit übernimmt Van Reybrouck letztlich die aristokratischen Vorstellungen, die er so leidenschaftlich kritisiert, wonach der gemeine Bürger im Grunde keine Ahnung habe und Entscheidungen daher richtigerweise von einem auserwählten Zirkel von Experten gefällt werden sollten – bloss, dass dieser Zirkel nun nicht mehr gewählt, sondern ausgelost werden soll.
Aristokratische Vorstellungen
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier einmal mehr Kritik an Ergebnissen mit Kritik an Prozessen vermischt wird und die direkte Demokratie als Prügelknabe herhalten muss, weil die Leute nicht immer so entscheiden, wie man es selbst gerne hätte. Dazu passt auch Van Reybroucks Reaktion auf den Entscheid der britischen Stimmbürger, aus der EU auszutreten. Die Abstimmung sei durch «schlecht informierte» Leuten entschieden worden, bemängelte der Wissenschaftler, für den offenbar feststeht, dass jeder «richtig» Informierte für den Verbleib in der Union stimmen muss.
Das Abdriften Van Reybroucks in Richtung solcher aristokratischer und bevormundender Vorstellungen ist vor allem deshalb zu bedauern, weil direkte Demokratie und deliberative Demokratie einander keineswegs «vollkommen entgegengesetzt» sind, wie er es uns glauben machen will – im Gegenteil: Sie könnten sich sogar gut ergänzen. Ausgeloste Gruppen von Bürgern sind gut dazu geeignet, Sachfragen nüchtern und ohne Druck von aussen zu diskutieren, neue Ideen aufzunehmen und geeignete Lösungen zu finden. Was diesen Gruppen jedoch fehlt, ist demokratische Legitimität und demokratische Kontrolle. Möglicherweise ist sich Van Reybrouck dessen selbst bewusst, denn er schreckt letztlich von der Forderung zurück, die endgültige Entscheidungsmacht ausgelosten Gruppen zu übertragen. Stattdessen schlägt er ein Zweikammer-System vor, in dem eine Kammer ausgelost und die andere gewählt wird. Was die ausgelosten Bürger ersinnen, muss also letztlich von gewählten Politikern bestätigt werden. Aber wenn man schon von der Vorstellung ausgeht, dass es keine Unterschiede zwischen Bürgern und Politikern geben soll – sollte man den Bürgern dann nicht auch zutrauen, dass sie diese Aufgabe mindestens so gut wie ihre Politiker erfüllen können?
[1] Oft geschah die Bestechung in Form von Einladungen zum Essen und (vor allem) Trinken: In Zug beispielsweise zechten 1760 die Wähler volle zwei Wochen lang auf Kosten zweier Kandidaten, die sich um das Amt eines Landvogts bewarben. (Quelle: Heinrich Ryffel (1903): Die Schweizerischen Landsgemeinden, S. 146-147)
[2] Bezeichnenderweise mussten im antiken Athen Kandidaten eine Tauglichkeitsprüfung (Dokimasie) absolvieren, bevor sie ein Amt antreten konnten. (Quelle: Bruno S. Frey und Margit Osterloh (2016): Aleatorische Demokratie, Working Paper, CREMA)
[3] David Van Reybrouck (2016): Gegen Wahlen. Warum Abstimmen nicht demokratisch ist, S. 156.
[4] Van Reybrouck 2016, S. 128-129.





 Was Van Reybrouck von den meisten Besorgten unterscheidet, ist seine Lösung. Das grundlegende Problem, schreibt er, sei das elektoral-repräsentative System, das sich in allen demokratischen Staaten etabliert hat. Dieses sei nämlich gar nicht demokratisch, sondern aristokratisch. Eine wahre Demokratie besetze Posten nicht durch Wahlen – sondern durch das Los.
Was Van Reybrouck von den meisten Besorgten unterscheidet, ist seine Lösung. Das grundlegende Problem, schreibt er, sei das elektoral-repräsentative System, das sich in allen demokratischen Staaten etabliert hat. Dieses sei nämlich gar nicht demokratisch, sondern aristokratisch. Eine wahre Demokratie besetze Posten nicht durch Wahlen – sondern durch das Los.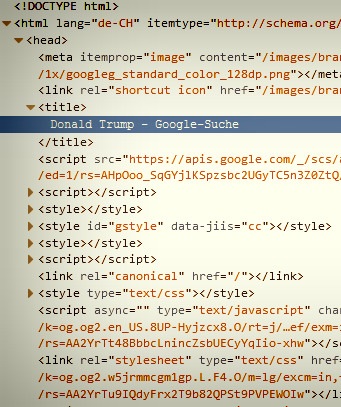


Recent Comments