Bevor die Schweiz in einer Woche ihr Parlament neu besetzt, werfen wir einen Blick zurück. In den 50 eidgenössischen Wahlen seit der Bundesstaatsgründung hat sich einiges an Überraschungen, Kuriositäten und Sonderfällen ereignet. Wir präsentieren fünf davon.
Schweizer Wahlen stehen nicht im Ruf, besonders ereignisreich zu sein. Erdrutschartige Verschiebungen, Parteien, die plötzlich implodieren, oder Bewegungen, die über Nacht zu dominanten Kräften aufsteigen – das alles gibt es in anderen Ländern wesentlich häufiger zu beobachten.
Und doch: Wer in der jüngeren und älteren Geschichte gräbt, stösst immer wieder auf bemerkenswerte und sonderbare Ereignisse.[1] Wir haben fünf davon herausgepickt, die wir an dieser Stelle erzählen. Es hätte genug weitere Anekdoten gegeben, die es ebenso wert gewesen wären zu erzählen. Man denke etwa an die Wahlen 1854, bei denen der Tessiner Stefano Franscini beinahe sein Amt verloren hätte, wären ihm nicht einige Parteifreunde zur Hilfe gekommen, so dass er letztlich im vierten (!) Wahlgang gewählt wurde – und zwar nicht im Tessin, sondern in Schaffhausen.[2] Auch die teilweise dreisten Wahlfälschungen und Manipulationen in den Gründungsjahren wären zu erwähnen.[3] Oder die ersten Wahlen im Proporz vor genau 100 Jahren, für die der Begriff Erdrutsch für einmal angebracht ist.[4] Oder die ersten Nationalratswahlen unter Beteiligung der Frauen 1971, die nicht annähernd so grosse Verschiebungen brachten, dafür viele neuen Gesichter – unter anderem jene von Frauen, die in ihrem Kanton noch gar nicht stimmberechtigt waren.
Hier widmen wir uns fünf anderen Geschichten, die mindestens so erwähnenswert sind:
Der Ralph Nader von Obwalden
Sechs Kantone haben derzeit nur einen Sitz im Nationalrat. Diese Sitze werden im Majorzverfahren besetzt – allerdings im Unterschied zu den Ständeratssitzen nicht in zwei Wahlgängen, sondern nur in einem. Massgebend ist das relative Mehr. Das hat zur Folge, dass der Wahlsieger unter Umständen deutlich weniger als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Der Minus-Rekord wurde 2007 aufgestellt, und zwar in Obwalden.[5]
Der Obwaldner Nationalratssitz war seit 1848 praktisch ununterbrochen in den Händen der CVP. Und deren Kandidat Patrick Imfeld hätte unter normalen Umständen wohl einem sicheren Sieg entgegenblicken können. Doch diesmal waren die Umstände anders. Nicht nur trat die SP das erste Mal mit einem eigenen Kandidaten an. Auch der politisch unerfahrene Filmemacher Luke Gasser bewarb sich um den Sitz. Und: Gasser, dessen Vater lange für die CVP im Regierungsrat sass, kündigte an, sich im Fall einer Wahl der CVP-Fraktion anzuschliessen. Damit war absehbar, dass der Aussenseiter viele CVP-Wähler abwerben würde.
Und tatsächlich: Bei den Wahlen am 21. Oktober 2007 holte Imfeld 32.5 Prozent der Stimmen – der schlechteste Wert für die CVP in Obwalden seit der Gründung des Bundesstaats. Gasser schaffte mit 23 Prozent einen Achtungserfolg, der SP-Kandidat Beat von Wyl kam auf 11.6 Prozent. Der lachende Vierte war der Kandidat der SVP, Christoph von Rotz, der mit 32.9 Prozent – nur gerade 300 Stimmen mehr als Imfeld – die Wahl in den Nationalrat schaffte. So wie in den USA im Jahr 2000 der Grüne Ralph Nader dem Demokraten Al Gore die Wahl zum Präsidenten vereitelt hatte, verhinderte der Christdemokrat in spe Gasser den Sieg des Christdemokraten Imfeld.
Auch in anderen Majorzkantonen wurden schon Kandidaten gewählt, die deutlich unter dem absoluten Mehr blieben. Der früheren FDP-Fraktionschefin Gabi Huber reichten 2003 bei ihrer ersten Kandidatur in Uri 36.6 Prozent der Stimmen. Und bei den Nationalratswahlen 2015 erkoren 36.1 Prozent der Ausserrhoder David Zuberbühler (SVP) zum Vertreter des Kantons in der grossen Kammer. In allen drei Fällen führten aussergewöhnliche Konstellationen zu einer eigentlichen Lotterie um den zu vergebenden Sitz. Wäre ein Kandidat weniger (oder mehr) angetreten, wäre das Resultat womöglich völlig anders ausgefallen.
Solche absurden Effekte liessen sich mit anderen Mehrheitswahlsystemen verhindern, etwa dem System der übertragbaren Stimmgebung (Single Transferable Vote) oder dem bewährten Verfahren mit zwei Wahlgängen. Zudem kommt die relative Mehrheitswahl tendenziell grösseren Parteien zugute, weil die Wähler faktisch gezwungen werden, ihre Stimmen auf chancenreichere Kandidaten zu konzentrieren, wenn sie nicht für den Papierkorb stimmen wollen. Es erstaunt daher nicht, dass es bisher keine Bestrebungen dieser Parteien für ein faireres Verfahren gab. Im Gegenteil: In der Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über die politischen Rechte, das 1976 beschlossen wurde, sprachen sich die Majorzkantone explizit gegen die Einführung eines zweiten Wahlgangs aus, wie ihn der Bundesrat vorschlug.
Stille Wahl, heilige Wahl
Erich Ettlin und Hans Wicki haben es geschafft: Sie sind als Ständeräte in Ob- und Nidwalden wiedergewählt. Und das bereits vor dem Wahltag. Weil keine Gegenkandidaten angetreten sind, hat eine stille Wahl stattgefunden. Bei Majorzwahlen in kleinen Kantonen sind stille Wahlen keine Seltenheit. In der Vergangenheit kamen sie aber auch schon bei Proporzwahlen vor. Das Wahlgesetz sieht vor, dass, wenn insgesamt nicht mehr Kandidaten zur Wahl antreten als Sitze zu vergeben sind, alle Kandidaten als gewählt erklärt werden.[6]
Besonders viele stille Wahlen gab es bei den Wahlen 1939, nämlich in nicht weniger als neun Kantonen. Während des Kriegs war die Lust der Parteien auf Wahlkämpfe gering.[7] Unter den neun waren auch grosse Kantone wie die Waadt (15 Sitze) oder Luzern (9 Sitze). In der Regel einigten sich die Parteien auf die Sitzverteilung gemäss den vorangehenden Wahlen.

Die letzten zwei still gewählten Nationalräte: Hans-Rudolf Früh (FDP) und Herbert Maeder (parteilos). (Fotos: www.parlament.ch)
Unangefochtener Rekordhalter in Sachen stillen Wahlen ist der Kanton Appenzell Ausserrhoden: Dort wurden die Nationalratssitze seit 1919 nicht weniger als neunmal vergeben, ohne dass ein einziger Wähler einen Wahlzettel ausfüllen musste. Zunächst hielt der Kanton noch drei Sitze in der grossen Kammer, von denen jeweils zwei den Freisinnigen und einer der SP zufiel; ab 1931 waren es zwei Sitze, die bis 1983 stets an FDP und SP gingen. Mit dieser Aufteilung schienen beide Seiten leben zu können, weshalb sie regelmässig auf einen Wahlkampf verzichteten. Von 1939 bis 1947 fanden drei Nationalratswahlen in Folge still statt. Allmählich nahm die politische Konkurrenz jedoch zu. 1975 trat die CVP erstmals in Ausserrhoden an. Acht Jahre später bewarb sich der parteilose Herbert Maeder mit einer eigenen Liste um einen Sitz – und schaffte mit 25.9 Prozent der Stimmen die Wahl. Als 1987 die beiden Bisherigen wieder antraten, wagte es niemand, sie herauszufordern. Es war die letzte stille Wahl in Ausserrhoden wie auch in einem Proporzkanton überhaupt. Seit 2003 hat Ausserrhoden nur noch einen Sitz im Nationalrat, dieser ist dafür umstritten, wie das Beispiel der Wahl 2015 zeigt (siehe oben). Stille Wahlen sind jedenfalls auch in Ausserrhoden Geschichte.
Bis dass das Los entscheidet

Marco Romano unmittelbar nach dem Losentscheid. Rechts ist Staatsrat Marco Borradori zu sehen, der das Los gezogen hatte. (Screenshot: SRF Tagesschau)
Trotz des in jüngerer Vergangenheit gestiegenen Interesses am Losverfahren in Demokratien setzt die Schweiz bei der Besetzung ihrer Parlamentskammern nach wie vor auf Wahlen. Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel: Zwei Abgeordnete haben in der Geschichte des Bundesstaats ihr Mandat dem Zufall zu verdanken.
Der jüngste Fall dürfte vielen noch in Erinnerung sein: Bei den Nationalratswahlen 2011 kamen im Tessin zwei CVP-Kandidaten auf genau gleich viel Stimmen.[8] Das Los musste zwischen Monica Duca und Marco Romano entscheiden. Die Schweiz schaute gespannt auf das Tessin, wo am 25. Oktober 2011 die Auslosung mittels Computer Duca zur Siegerin kürte. Doch die Freude der CVP-Politikerin war verfrüht: Aufgrund mehrerer Beschwerden hob das Bundesgericht das Ergebnis auf: Die elektronische Auslosung wie auch der Ausschluss der Öffentlichkeit waren gesetzeswidrig.[9] Die Auslosung wurde einen Monat später wiederholt, öffentlich und manuell – und diesmal war das Glück auf der Seite Romanos.
Der erste Fall, in dem das Los einen Nationalrat kürte, hatte sich schon einiges früher ereignet, nämlich 1939.[10] Damals war es keine Seltenheit, dass die Mitglieder kantonaler Exekutiven gleichzeitig im Bundesparlament sassen. In einzelnen Kantonen allerdings, darunter Baselland, schränkte die Kantonsverfassung diese Praxis ein, indem sie festlegte, dass maximal ein Regierungsrat im National- oder Ständerat Einsitz nehmen durfte.[11] Dessen waren sich auch die beiden Regierungsräte Hugo Gschwind (Katholisch-Konservative) und Walter Hilfiker (SP) bewusst. Gleichwohl versuchten beide ihr Glück als Kandidaten für den Nationalrat. Beide wurden gewählt.

Hugo Gschwind. (Foto: StABL)
Weil nicht beide im Parlament einsitzen konnten und keiner auf das Amt verzichten wollte, stellte sich die Frage, wer antreten durfte. Das kantonale Recht legte zwar fest, dass nur ein Regierungsrat im Nationalrat sitzen durfte, enthielt jedoch keine Bestimmung darüber, wie man in einem solchen Fall bestimmt, wer das sein sollte. Die Anhänger beider Regierungsräte brachten verschiedene Kriterien vor, die man heranziehen könnte (Alter, Amtsdauer, Stimmenzahl usw.). Weil aber für keines davon eine Rechtsgrundlage bestand, entschied der Regierungsrat, dass der Zufall entscheiden musste.
Am 10. November 1939 wurde in der Sitzung des Regierungsrats das Los gezogen. Dabei wurden zwei Kuverts mit den Namen der beiden Gewählten mit acht leeren Kuverts gemischt und dann eines nach dem anderen geöffnet, bis eines mit einem Namen gezogen wurde. Der Zufall erwählte den Konservativen Gschwind. Hilfiker musste seinen Sitz dem Zweiten auf der SP-Liste überlassen. Das dürfte ihn deshalb besonders geärgert haben, weil er mehr als doppelt so viele Stimmen geholt hatte als sein Kontrahent Gschwind, dessen Partei nur dank einer Listenverbindung mit den Freisinnigen ein Mandat errang.
Gschwind blieb das Glück allerdings nicht lange hold. 1943 verloren die Konservativen ihr Mandat bereits wieder – und zwar an die SP, die einen zweiten Sitz dazu gewann. Diesen wiederum sicherte sich ein gewisser Walter Hilfiker.
Der Pfarrer, der kein Geistlicher sein wollte
Die Bundesverfassung von 1848 gab zwar (
zumindest theoretisch) allen männlichen Bürgern das aktive Wahlrecht. Beim passiven Wahlrecht schränkte sie den Kreis allerdings ein. Gemäss Artikel 64 war «jeder stimmberechtigte Schweizer Bürger weltlichen Standes» in den Nationalrat wählbar.
[12] Geistliche waren damit vom Einsitz in der grossen Kammer ausgeschlossen. Die Bestimmung geht auf den Kulturkampf zurück und das Misstrauen der Freisinnigen gegenüber papsttreuer Ultramontaner, die den Staat unterwandern könnten. Betroffen von der Einschränkung waren aber nicht nur katholische, sondern auch protestantische Pfarrer.
In der Praxis wurde die Regelung so angewandt, dass Angehörige des geistlichen Standes zwar zur Wahl antreten konnten, im Fall einer Wahl aber entweder auf ihr Pfarramt oder auf das Parlamentsmandat verzichten mussten. So erklärte Ernst Sieber nach seiner Wahl als EVP-Nationalrat 1991 den Verzicht auf sein Pfarramt in Zürich per Februar 1992.
Einer allerdings wollte die Unvereinbarkeit von geistlichem und politischem Amt nicht akzeptieren und kämpfte vehement darum, beides behalten zu dürfen. Dabei handelte es sich nicht um einen konservativen Ultramontanen, sondern einen protestantischen Sozialdemokraten. Arnold Knellwolf, Pfarrer im Berner Dorf Erlach, wurde 1917 für die SP gewählt.[13] Vor dem Wahltag erklärte er auf Anfrage der Berner Regierung zunächst, im Fall einer Wahl auf sein Pfarramt zu verzichten. Wenig später tönte es allerdings anders: In einem an den Nationalrat gerichteten Brief schrieb er, dass er bereit sei, von seinem kirchlichen Amt zurückzutreten – unter dem Vorbehalt, dass es ihm nicht erlaubt würde, dieses Amt zu behalten. Warum sollte das Parlament gerade bei ihm eine Ausnahme machen? Knellwolf argumentierte, dass der besagte Artikel nur für Katholiken gelte. Reformierte Pfarrer hingegen gehörten nicht dem geistlichen Stand an. Diese Interpretation stand im Widerspruch zur vorherrschenden Rechtslehre. Der Nationalrat validierte denn auch die Wahl Knellwolfs nur unter der Bedingung, dass er sein Pfarramt niederlege.
Knellwolf allerdings hatte andere Pläne. Kaum im Parlament, forderte er vom Bundesrat via Motion einen Bericht, um die Frage zu prüfen, ob Artikel 75 der Verfassung auch auf reformierte Pfarrer anwendbar sei. Das Parlament überwies den Vorstoss, doch lag der Bericht des Bundesrats noch nicht vor, als Knellwolf 1919 zur Wiederwahl antrat – nach wie vor in kirchlichem Amt und Würden. Trotz der deutlichen Sitzgewinne der Sozialdemokraten verpasste «der temperamentvolle Pfarrherr von Erlach», wie ihn ein Ratskollege einmal nannte, die Wiederwahl. Damit wurde ihm die Wahl zwischen kirchlichem und politischem Amt erspart.
Die Episode hätte damit als abgeschlossen betrachtet werden konnte, wenn nicht eineinhalb Jahre später SP-Nationalrat August Rikli zurückgetreten wäre. Knellwolf konnte nachrücken, und die Frage seiner Wählbarkeit stellte sich erneut. Diesmal beharrte der Pfarrer, der kein Geistlicher sein wollte, ultimativ auf seinem kirchlichen Amt. Er erklärte, dass er zumindest solange Pfarrer bleiben wollte, bis das Parlament über das weitere Schicksal von Artikel 75 entschieden hätte. Der Bundesrat hatte inzwischen seinen Bericht vorgelegt, in dem er die Auffassung bekräftigte, dass der Artikel auch für Protestanten gelte. Auch der Nationalrat wollte von einer Praxisänderung nichts wissen und verweigerte die Validierung von Knellwolfs Wahl.[14]
So endete die Karriere des politisierenden Pfarrers, und 1923 erklärte sich der Nationalrat mit den Schlussfolgerungen des Bundesrats einverstanden, so dass Knellwolfs Anliegen gescheitert war. Erst 1999 sah man die Gefahr des politischen Einflusses von Geistlichen im Nationalrat gebannt und strich den Artikel aus der Verfassung.
Der Hans Dampf in allen Kantonen
Im Gegensatz zu Ländern mit Präsidialsystem gibt es in der Schweiz kein Amt, das von allen Stimmbürgern des Landes gewählt wird. Die Volkswahl des Bundesrats wurde zwar immer wieder diskutiert, aber genauso oft verworfen – erstmals bereits in der Verfassungskommission von 1848. Ein Argument gegen die Volkswahl war damals, dass ein landesweiter Wahlkampf zu teuer wäre und sich nicht genug «fähige Männer» für die Regierung finden würden.
Dennoch haben die Politiker früh die Vorzüge des grenzüberschreitenden Wahlkampfs erkannt. Bereits in den Anfangsjahren, als noch im Majorz gewählt wurde, war es keine Seltenheit, dass Kandidaten in mehreren Wahlkreisen antraten. In der Regel waren es besonders bekannte und populäre Köpfe, die als «Wahlkampflokomotiven» eingesetzt wurden und die Wähler der eigenen Seite mobilisieren sollten. So liess sich der nachmalige Bundesrat Ulrich Ochsenbein bei den ersten Nationalratswahlen 1848 in vier der sechs Berner Wahlkreise aufstellen.
Mit der Einführung des Proporzes und der damit verbundenen Vergrösserung der Wahlkreise verlor diese Strategie an Relevanz, zumal nur wenige Politiker über ihren Kanton (der ja nun ihr Wahlkreis war) hinaus Bekanntheit erlangten. Doch es gab Ausnahmen. Eine davon war Gottlieb Duttweiler. Der Migros-Gründer war bereits landesweit bekannt, als er 1935 in die Politik einstieg und in Zürich, Bern und St. Gallen «Unabhängige Listen» für die Nationalratswahlen lancierte (aus denen später der Landesring der Unabhängigen entstehen sollte).[15] Seiner nationalen Ausstrahlung bewusst, trat er in allen drei Kantonen gleich selber als Spitzenkandidat an.
Der Coup gelang: Die neue Bewegung gewann auf Anhieb sieben Sitze. Und wenig überraschend erzielte Duttweiler sowohl in Zürich als auch in Bern und St. Gallen jeweils mit Abstand das beste Resultat seiner Liste. Er konnte also auswählen, welchen Kanton er im Nationalrat vertreten wollte. Schliesslich entschied er sich, die Wahl in Bern anzunehmen. In Zürich und St. Gallen rückten Ersatzkandidaten nach.
Bei den anderen Parteien kam Duttweilers Dreifachkandidatur indes nicht besonders gut an. Bald wurden Stimmen laut, die solche Manöver unterbinden wollten. Aufgrund einer Motion erarbeitete die zuständige Kommission des Nationalrats eine Vorlage für eine Ergänzung des Bundesgesetzes betreffend die Wahl des Nationalrats. Die neue Bestimmung legte fest, dass niemand in mehr als einem Kanton als Nationalratskandidat antreten dürfe. Die Vorlage wurde von National- und Ständerat in der Sommersession 1939 angenommen, gerade noch rechtzeitig für die Wahlen im Oktober.
Der Hauptbetroffene der «Lex Duttweiler» hielt sich an die neue Regel, doch scheint sich Duttweiler weiterhin schwergetan zu haben, sich politisch auf einen Kanton festzulegen: Er trat nämlich nicht mehr in Bern zur Wahl an, sondern in Zürich. Dort schaffte er 1949 auch die Wahl in den Ständerat, verpasste zwei Jahre später jedoch die Wiederwahl und wurde erneut Nationalrat, diesmal wieder für den Kanton Bern, den er bis zu seinem Tod 1962 in der grossen Kammer vertrat.
[1] Der vorliegende Artikel ist massgeblich inspiriert von: Hans-Urs Wili (2002): Nationalratswahlen. Präzedenzfälle.
[2] Siehe Der unbekannte Schaffhauser Bundesrat.
[3] Siehe unter anderem Als in Luzern nach Gesteinsarten gewählt wurde und Chaos, Manipulationen und Rekorde.
[4] Siehe Der Machtverlust des Freisinns – und wer davon wirklich profitierte.
[5] BBl 2007 8103-8104.
[6] Art. 45 Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR).
[7] In den Majorzwahlkreisen sind stille Wahlen erst seit 1994 möglich.
[8] BBl 2011 8529-8530.
[9] BGE 138 II 13.
[10] BBl 1939 II 674.
[11] Ab diesen Wahlen ist der gleichzeitige Einsitz im Regierungsrat und im Bundesparlament ganz ausgeschlossen (Siehe Was ist neu bei den Wahlen 2019? [Teil II: kantonales Recht])
[12] In der totalrevidierten Bundesverfassung von 1874 als Artikel 75 übernommen.
[13] BBl 1917 IV 706-708.
[14] Verhandlungen des Nationalrats, 21.4.1921.
[15] BBl 1935 II 677.
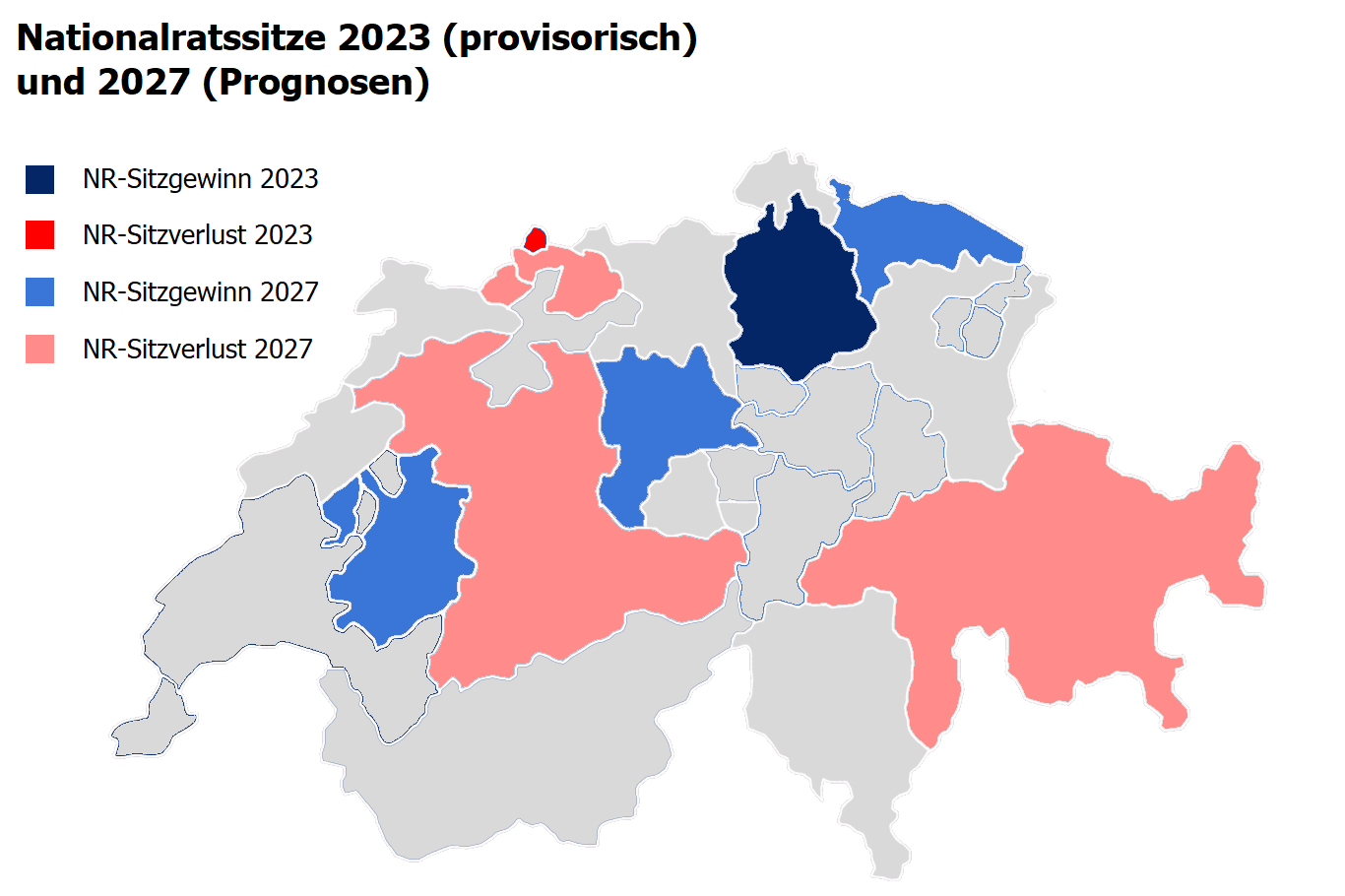
















Recent Comments