Die Redaktion von «Napoleon’s Nightmare» stellt ein gutes Dutzend empfehlenswerte Neuerscheinungen des Jahres 2020 vor. Die Publikationen blicken in die Vergangenheit mit dem Unruheherd Bundesrat oder dem Jurakonflikt, in die Gegenwart mit dem Rahmenabkommen und der Coronakrise sowie in die Zukunft mit Diskussionsanstössen zur Demokratie.
Von Claudio Kuster und Lukas Leuzinger
 Urs Altermatt: Vom Unruheherd zur stabilen Republik – Der schweizerische Bundesrat 1848–1875 (NZZ Libro)
Urs Altermatt: Vom Unruheherd zur stabilen Republik – Der schweizerische Bundesrat 1848–1875 (NZZ Libro)
Bekannt ist Urs Altermatt vor allem für das «Bundesratslexikon»; das Standardwerk ist vergangenes Jahr in vollständig überarbeiteter und aktualisierter Auflage erschienen. Als Ergänzung zu den Kurzbiografien aller Bundesratsmitglieder seit 1848 legt der Freiburger Historiker mit «Vom Unruheherd zur stabilen Republik» nun den ersten Band eines Werks vor, das die Bundesräte in die politischen Themen und Entwicklungen ihrer Zeit einordnet.
Das Buch erzählt die Entstehung und Entwicklung des schweizerischen Bundesstaats und seiner sonderbaren Regierungsform bis zur Verfassungsrevision von 1874 grob chronologisch. Dabei wird der Leser daran erinnert, dass von der an Langeweile grenzende Stabilität des Bundesrats im 20. und 21. Jahrhundert zu den Anfangszeiten nichts zu spüren war. Die Konkordanzkultur funktionierte mehr schlecht als recht (in Bezug auf die katholische Minderheit sowieso) und die Bundesratswahlen waren geprägt von Intrigen und offenen Machtkämpfen. Auch der Streit über die Revision der Bundesverfassung sorgte für Unruhe und sogar den Rücktritt eines Bundesrats (Jakob Dubs 1872). Laut Altermatt werden diese Konflikte gerne ausgeblendet, weil sie nicht in die «Meistererzählung» passten, «die Politiker und Publizisten seit dem 19. Jahrhundert für die Entstehung des helvetischen Konsenses konstruiert haben».
Das Buch ist aber nicht nur lehrreich, sondern immer wieder auch unterhaltsam. So erfährt man, dass die Bundesräte ab den 1860er Jahren regelmässige «Bundesratsabende» durchführten, um die Kollegialität zu fördern. Über den Sinn solcher geselliger Treffen gingen die Meinungen freilich auseinander. So ärgerte sich der Berner Bundesrat Schenk in seinem Tagebuch über die ausufernden Würfelspiele: «Es wird mir bald unangenehm, weil es eine nutzlose Zeitverschwendung ist und weil es zu grösseren Ausgaben führt, als mir lieb ist.» Vielleicht würde es nicht schaden, wenn heutige Magistraten ihr Konkurrenzdenken bei gelegentlichen Würfelrunden auslebten statt im politischen Alltag.
 Adrian Vatter: Der Bundesrat – Die Schweizer Regierung (NZZ Libro)
Adrian Vatter: Der Bundesrat – Die Schweizer Regierung (NZZ Libro)
Ein weiteres Buch über den Bundesrat, wenn auch aus gänzlich anderer Perspektive, legt der Berner Politikwissenschafter Adrian Vatter vor. Im Gegensatz zu Altermatt fokussiert er nicht auf die historische Erzählung, sondern auf die wissenschaftliche Untersuchung der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit. Sein Anspruch macht dabei bereits der Titel klar: «Der Bundesrat» soll das Standardwerk über die Schweizer Regierung sein. Entsprechend breit geht er an sein Forschungsobjekt heran: Von der politikwissenschaftlichen Einordnung im internationalen Vergleich über die Wahlchancen in Abhängigkeit verschiedener Faktoren bis zur Analyse der Persönlichkeitsmerkmale der Bundesratsmitglieder wird alles abgedeckt. Selbst die Auftritte der Magistraten auf den Titelseiten der «Schweizer Illustrierten» und «L’Illustré» werden analysiert (wobei Adolf Ogi obenaus schwingt).
Neben dieser Breite (die leider zuweilen auf Kosten der Tiefe geht) hebt sich Vatters Buch auch dadurch ab, dass dafür eine schriftliche Umfrage unter sämtlichen amtierenden und noch lebenden ehemaligen Bundesratsmitglieder durchgeführt wurde, ergänzt durch rund ein Dutzend mündlicher Interviews. Auf Basis dieser Befragungen sowie weiteren Quellen kategorisiert Vatter die Bundesräte in sechs unterschiedliche Typen (z.B. «Regenten», «Verwalter» oder «Populäre»). Diese Typologisierung ist der öffentlichen Aufmerksamkeit für das Buch zweifellos nützlich, auch wenn ihr wissenschaftlicher Wert in Zweifel gezogen werden kann.
Insgesamt ist «Der Bundesrat» eine eindrückliche Übersicht über die Zusammensetzung der Schweizer Regierung und ihrer Funktionsweise. Wer sich regelmässig mit dem Bundesrat befasst, dem wird das Buch auf Jahre hinaus als Nachschlagewerk und Analyseinstrument wertvolle Dienste leisten.
 Corsin Bisaz: Direktdemokratische Instrumente als «Anträge aus dem Volk an das Volk» – Eine Systematik des direktdemokratischen Verfahrensrechts in der Schweiz (Dike)
Corsin Bisaz: Direktdemokratische Instrumente als «Anträge aus dem Volk an das Volk» – Eine Systematik des direktdemokratischen Verfahrensrechts in der Schweiz (Dike)
Corsin Bisaz (Zentrum für Demokratie Aarau/Universität Zürich) hat für den Titel seiner Habilitationsschrift eine so schöne wie passende, alte bundesgerichtliche Umschreibung des Volksinitiativrechts ausgegraben: «Anträge aus dem Volk an das Volk». Seine umfangreiche Untersuchung systematisiert das Verfahrensrecht der direktdemokratischen Instrumente in der Schweiz, von der Bundesebene über die Kantone bis tief hinein in die unterschiedlichsten kommunalen Formen der unmittelbaren Demokratie.
Im ersten Teil («Das Volk») wird das Subjekt des direktdemokratischen Verfahrens angesprochen: Wie ist das Stimmvolk als Staatsorgan zusammengesetzt? Wem genau kommt das Antrags-, Beratungs- und Beschlussrecht zu? – Der zweite Teil («Der Antrag») beleuchtet die mannigfaltigen Antragsarten, also Ordnungsanträge (beispielsweise Rückweisung des Geschäfts oder Schluss der Diskussion, aber auch die Volksinitiative auf Totalrevision der Verfassung oder das Referendumsrecht) auf der einen und Sachanträge auf der anderen Seite. Letztere sind etwa bekannt als Einzelinitiative an der Gemeindeversammlung, als Memorialsantrag an der Landsgemeinde oder als klassische Volksinitiative auf Teilrevision der Verfassung. Hier werden auch die Gültigkeitserfordernisse von Anträgen systematisiert, von Bekannterem (Einheit der Materie, Beachtung übergeordneten Rechts) über Speziellerem (Präzise Formulierung) bis hin zu Fragwürdigem (Einheit der Form, die bloss Probleme löst, die sie selbst erst schafft).
Teil 3 widmet sich dem Verfahren der direktdemokratischen Instrumente, vom Vorprüfungsverfahren über Unterschriftensammlungen und Gültigkeitsprüfungen bis hin zu Abstimmungsempfehlungen. Zuletzt (vierter Teil: «Die Beschlussfassung») wird die Art der Stimmabgabe sowie die verschiedenen Typen von Volksabstimmungen untersucht (Grundsatz-, Eventual-, Variantenabstimmung usw.). Hier wird ein besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen bei Antragshäufung gelegt, wie also abgestimmt wird (oder werden sollte), wenn mehr als ein Antrag vorliegt. – Zum Schluss (fünfter Teil) wird die Natur und der Inhalt des Organakts Volksentscheid kurz umrissen.
Die eigentliche Stärke, ja das Novum des Buchs liegt darin, dass die direktdemokratischen Instrumente in ihrer Gesamtheit rechtsdogmatisch einheitlich erfasst und nicht in den sonst üblichen Dualismus Versammlungssystem/Urnendemokratie separiert werden («Heute liegen die direktdemokratischen Instrumente und Verfahren durch ihre Ausdifferenzierung merkwürdig isoliert nebeneinander.»). Dadurch, dass Bisaz die wesentlichen verfahrensrechtlichen Aspekte direkter Demokratie herausstellt, können darauf basierend Leitplanken für allfällige Weiterentwicklungen direktdemokratischer Verfahren aufgezeigt werden. Zu denken ist hier insbesondere an die etwaige Digitalisierung der direkten Demokratie, die letztlich ebenfalls Elemente (aber auch Nachteile und Gefahren) sowohl der Versammlungs- als auch der Urnendemokratie aufgreifen können wird.
 Nadja Braun Binder / Thomas Milic / Philippe E. Rochat: Die Volksinitiative als (ausser-)parlamentarisches Instrument? – Eine Untersuchung der Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees und der Trägerschaft von Volksinitiativen (ZDA/Schulthess)
Nadja Braun Binder / Thomas Milic / Philippe E. Rochat: Die Volksinitiative als (ausser-)parlamentarisches Instrument? – Eine Untersuchung der Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees und der Trägerschaft von Volksinitiativen (ZDA/Schulthess)
Wie viel «Volk» steht eigentlich in den hiesigen Volksinitiativen? Staatsrechtsprofessorin Nadja Braun Binder und die beiden Politikwissenschafter Thomas Milic und Philippe E. Rochat wollten genauer erfahren, welche Akteure die direkte Demokratie effektiv nutzen. In ihrer aufwendigen empirischen Studie analysieren und kategorisieren sie hierzu hunderte Initiativkomitees seit den 1970er Jahren respektive die einzelnen Mitglieder deren, um auf dieser Basis schliesslich diverse quantitative Aussagen zu den Urhebern abzuleiten.
Acht von zehn lancierten Initiativen stammen entweder von Parteien oder etablierten Verbänden und Organisationen. Das «Volk» demgegenüber ist weit seltener direktdemokratisch aktiv: Ausserparlamentarische, zivilgesellschaftliche Gruppierungen stehen nur gerade hinter 17 Prozent aller Volksbegehren. Besonders initiativfreudig sind die (Bundes-)Parlamentarier der SP: In jedem dritten Initiativkomitees sind SP-Parlamentarier vertreten. SVP- und Grüne-Parlamentarier sind ebenfalls relativ oft als Urheber von Volksinitiativen anzutreffen (in jeder vierten Initiative vertreten). Parlamentsmitglieder in den eigenen Reihen zu haben, scheint zu helfen: Komitees mit Parlamentariern bringen zu 77 Prozent ihre Initiative zustande, während solche rein zivilgesellschaftlicher Provenienz nur gerade zu 36 Prozent die Hürde der Unterschriftensammlung meistern.
Dass die Parteien so oft zu diesem Instrument greifen, mag erstaunen, hält man sich vor Augen, dass die SP, die Grünen, die FDP und die CVP noch kein einziges ihrer als «Parteiinitiative» kategorisierter Begehren erfolgreich durch die Volksabstimmung brachten. Diese Diskrepanz hat verschiedene Gründe: Zum einen dienen Initiativen auch anderen (Profilierungs-)Zwecken, Zum anderen forcieren sie oftmals Gegenvorschläge. – Die an der Urne erfolgreichste Partei ist die SVP, was insofern erstaunlich ist, als die grösste Partei erst seit dem EWR-Nein überhaupt davon Gebrauch macht. Ein paar Jahre vorher wollte sie das Volksrecht in dieser Form gar noch abschaffen.
 Matthias Lanz: Bundesversammlung und Aussenpolitik – Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer Mitwirkung (Dike)
Matthias Lanz: Bundesversammlung und Aussenpolitik – Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer Mitwirkung (Dike)
Die Aussenpolitik ist traditionelle Domäne der Regierung. Durch die Internationalisierung haben sich zudem in den letzten Jahrzehnten wichtige Entscheidprozesse von der Staats- auf bilaterale oder gar globale Ebene verschoben – man denke nur an die Europapolitik, diverse Freihandelsverträge oder den Uno-Migrationspakt. Auch wenn der Bundesrat die Schweiz nach aussen vertritt und die auswärtigen Angelegenheiten besorgt, sind hier dem Parlament die Hände keineswegs gebunden: «Die Bundesversammlung beteiligt sich an der Gestaltung der Aussenpolitik […]» – so räumt die Bundesverfassung in Artikel 166 der Legislative ein Mitwirkungsrecht ein. Matthias Lanz (Universität Bern) systematisiert in seiner rechtswissenschaftlichen Dissertation das erstaunlich mannigfaltige Instrumentarium, das Nationalrätinnen und Ständeraten offensteht, um aussenpolitischen Einfluss zu üben.
Einerseits stehen dem Parlament die Stammfunktionen wie die Rechtsetzung, die Finanzkompetenzen, die Oberaufsicht und die verschiedenen Vorstossarten zur Verfügung, die es allesamt vermehrt für aussenpolitische Fragen einsetzt. Ein Nischendasein fristet, auch in diesem Bereich, die politische Planung (wie Grundsatzbeschlüsse oder die Legislaturplanung), die praktisch kaum fruchtbar gemacht wird. Andererseits existieren diverse spezifische parlamentarische Kompetenzen in der Aussenpolitik wie die Genehmigung von völkerrechtlichen Verträgen, das Informations- und Konsultationsrecht der Aussenpolitischen Kommissionen oder die ständigen Delegationen der Bundesversammlung (etwa für EFTA/EU, Europarat oder OSZE). – Lanz zeigt die Möglichkeiten, aber auch Grenzen der parlamentarischen Mitwirkung anschaulich auf. Leider problematisiert er unnötigerweise den punktuellen Gebrauch des Motionsrechts, mit dem das Parlament, die oberste Gewalt im Bund, dem Bundesrat Aufträge erteilen kann – auch in der Aussenpolitik.
 Felix E. Müller: Kleine Geschichte des Rahmenabkommens – Eine Idee, ihre Erfinder und was Brüssel und der Bundesrat daraus machten (NZZ Libro)
Felix E. Müller: Kleine Geschichte des Rahmenabkommens – Eine Idee, ihre Erfinder und was Brüssel und der Bundesrat daraus machten (NZZ Libro)
Um das institutionelle Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU ist es im vergangenen Jahr ziemlich ruhig geworden – die Pandemie hat hüben wie drüben andere Probleme in den Vordergrund gerückt. Felix E. Müller (ehemaliger Chefredaktor der «NZZ am Sonntag») hat diese Ruhe vor dem Sturm genutzt und in seiner «Kleinen Geschichte des Rahmenabkommen» die Entstehungsgeschichte dieses Ende 2018 veröffentlichten Vertragsentwurfs recherchiert. Dabei konnte er auf die Erfahrungen und das Wissen diverser involvierter Diplomaten (wie Michael Ambühl, Roberto Balzaretti und Yves Rossier) und der beiden alt Bundesräte Johann Schneider-Ammann und Micheline Calmy-Rey zurückgreifen – Letztere hat gar ein ausführliches Vorwort beigesteuert.
Das Rahmenabkommen wurde nicht, wie vielleicht breite Kreise annehmen, von Brüsseler Technokraten ersonnen, sondern ist ursprünglich eine genuin helvetische Idee: Bereits Ende der 1990er Jahre hat eine Genfer «Groupe de réflexion» um den ehemaligen Ständerat Franz Muheim (UR, CVP) ein Assoziationsabkommen skizziert und dieses später in den politischen Prozess eingespiesen. Die Motivation dahinter war, den damals eingeleiteten Bilateralismus (der aus Sicht der EU ja nur ein Übergangsregime zum Vollbeitritt darstellte!) langfristig abzusichern. Teilweise wurde damit aber auch eine politische Integration angestrebt. Erst viel später konnte sich dann auch die EU mit dieser Idee anfreunden, zumal sie darin einen Hebel erkannte, um die stetige Aktualisierung der bestehenden Verträge zu vereinfachen und den Binnenmarkt zu homogenisieren. – Herausgekommen sei unterdessen aber ein Abkommen, das sichtlich von den Erwartungen und Zielen abweiche, die dessen Vordenker um das Jahr 2000 formuliert hatten. Der damalige Ständerat Philipp Stähelin reichte damals als erster einen Vorstoss ein, um einen Rahmenvertrag für die zukünftigen bilateralen Verträge mit der EU auszuloten. Heute gebe er zu bedenken, man habe damals an ein ganz anderes Abkommen gedacht als dasjenige, das nun vorliege. Es sei ihnen um eine Art Steuerungsmechanismus gegangen, um einen Standard, um einheitliche Prozeduren und Abläufe. Im nun vorliegenden Vertragsentwurf habe es demgegenüber viel mehr Inhaltliches. Er spielt damit auf die aktuellen materiellen Diskrepanzen wie die flankierenden Massnahmen/Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie und Staatsbeihilfen an.
Müller schliesst sein nüchternes und dennoch spannendes Büchlein ohne Empfehlung zum Vertragsentwurf. Früher oder später werde der Entscheid von einer Kosten-Nutzen-Rechnung abhängen, die das Schweizer Volk werde vornehmen müssen. «Es wird ein Entscheid sein, der die Furcht vor drohenden wirtschaftlichen Nachteilen gegen Bedenken über souveränitätsrechtliche Einschränkungen abzuwägen hat. Die Schweiz ist ja in ihrem Verhältnis zur EU stets hin und her gerissen zwischen diesen beiden Aspekten, was auch erklären dürfte, weshalb ihre Haltung in der ganzen Diskussions- und Verhandlungsphase um ein Rahmenabkommen nie sehr kohärent war.»
 Oliver Zimmer: Wer hat Angst vor Tell? – Unzeitgemässes zur Demokratie (Echtzeit)
Oliver Zimmer: Wer hat Angst vor Tell? – Unzeitgemässes zur Demokratie (Echtzeit)
Als Schweizer Geschichtsprofessor, der an der Oxford University lehrt, ist Oliver Zimmer nicht der naheliegendste Autor, um eine Fundamentalkritik an den liberalen Eliten und der «Hyperglobalisierung» zu üben. Andererseits verleiht sein persönlicher Hintergrund seinem neuen Buch auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. «Wer hat Angst vor Tell?» ist eine provokative Kritik dessen, was Zimmer als «neuen Liberalismus» bezeichnet, der einen «Hang zu technokratischen Lösungen mit einem auf das Individuum und seine Rechte zentrierten Supranationalismus» verbindet und seine Anhängerschaft in einer «Allianz von Geld und Geist» findet. Die Idee einer einheitlichen globalistischen Ideologie, welche die Politik dominiert, wirkt etwas konstruiert, zumal die Politik in westlichen Demokratien in den vergangenen Jahren nicht eine sonderlich liberale Richtung eingeschlagen hat.
Letztlich geht es Zimmer aber um etwas anderes, nämlich um das schwierige Verhältnis des Liberalismus zur Demokratie. Er stellt fest, dass «ein republikanischer Liberalismus, der auf demokratische Teilnahme und bürgerliche Verantwortung setzt, (…) fast überall zur gefährdeten Spezies geworden» ist. Der Bezug auf Wilhelm Tell im Titel verweist darauf, dass liberale Freiheitsrechte für Zimmer notwendigerweise in einer kollektiven Gemeinschaft verwurzelt und verankert sein müssen. Hier setzt seine Kritik am «neuen Liberalismus» an, der den Nationalstaat als vormodern und moralisch defizitär verachtet, während er supranationale Institutionen wie die EU mit der selben mythologischen Verklärung betrachtet, die er am Nationalismus belächelt. Anhand von Beispielen wie der Rechtsprechung des EuGH und des EGMR zeigt er auf, wie unter Berufung auf höhere Zwecke die Demokratie auf nationalstaatlicher Ebene unterhöhlt wird. Als mögliches Gegenmodell tönt Zimmer einen Konservatismus an, der «‹progressive›, nach ‹Europa› und ‹zur Welt› hin führenden Mythenerzählungen genauso ab[lehnt] wie die nationalistischen, die uns im ‹nationalen Reduit› verewigen wollen».
 Beat Kappeler: Der Superstaat – Von Bürokratie und Parteizentralen und wie man den schlanken Staat zurückgewinnt (NZZ Libro)
Beat Kappeler: Der Superstaat – Von Bürokratie und Parteizentralen und wie man den schlanken Staat zurückgewinnt (NZZ Libro)
Regierungen erpressen Parlamente und hebeln die Gewaltenteilung aus, Politiker delegieren schleichend Kompetenzen an inter- und supranationale Organisationen, Zentralbanken spannen mit der Politik zusammen und öffnen die Geldschleusen, um deren Schulden zu bezahlen oder zu entwerten. Die Vorgänge der jüngeren Vergangenheit in westlichen Demokratien sind beunruhigend. Gemeinsam ist ihnen, dass die Macht konzentriert und zentralisiert wird. Die Staatsmacht dehnt sich aus, während sie sich immer mehr vom Bürger und seiner Kontrolle entfernt. Das ist die Kernthese des Publizisten Beat Kappeler in «Der Superstaat». Wie man es von seinen früheren Kolumnen gewohnt ist, kritisiert und analysiert er mit spitzer Feder den Ausbau der Staatsmaschinerie. Dabei taucht er tief in diese Maschinerie ein und beschreibt etwa die Auswirkungen der Vertrauensfrage, die als Kontrollinstrument des Parlaments gegenüber der Regierung gedacht war, tatsächlich aber der Regierung hilft, dem Parlament ihren Willen aufzudrücken. Oder die Macht der Parteizentralen, die oft die Zusammensetzung der Parlamente und Kabinette bestimmen. Oder die Tendenz internationaler Gremien und Organisationen, den eigenen Auftrag auszuweiten.
Gegen diese Tendenzen helfen laut Kappeler institutionelle Regeln. So reduziert die Möglichkeit des Panaschierens auf Wahllisten die Macht der Parteizentralen, und das Proporzsystem bricht die Macht selbst der stärksten Parteien, Entscheide allein durchzudrücken. Ein explizites Verbot von Staatsfinanzierung über die Notenpresse würde die Politik zwingen, die Verantwortung für Schulden nicht auf die Notenbanken abzuschieben.
 Tamara Ehs: Krisendemokratie – Sieben Lektionen aus der Coronakrise (Mandelbaum)
Tamara Ehs: Krisendemokratie – Sieben Lektionen aus der Coronakrise (Mandelbaum)
Tamara Ehs (Politikwissenschafterin an der Universität Wien und selbstständige Beraterin für mehr Demokratie in österreichischen Städten und Gemeinden) zeigt in ihrem Essay «Krisendemokratie» auf, wie sich die ersten Monate der Pandemie auf Österreichs Demokratie und Rechtsstaat ausgewirkt haben. Die Akutphase der Covid-Krise habe «wie ein Brennglas den Blick auf die Stärken und Schwächen der österreichischen Demokratie ermöglicht. Wo es gute Routinen gab, funktionierten die Abläufe auch im Stress der Ausnahmesituation. Jene Bereiche, in denen das politische System aber schon im Regelzustand holprig läuft, gerieten in der Krise zum Stolperstein.» In sieben kurzen Lektionen legt Ehs ihren Finger auf Problembereiche wie der heruntergefahrene Parlamentsbetrieb und die schludrige Gesetzgebungsarbeit, die mangelnde Transparenz der Entscheidungsgrundlagen sowie die Angst- und Kriegsrhetorik der Regierung Sebastian Kurz. Weiter bemängelt sie die zahlreichen grundrechtlichen Eingriffe in die Demonstrationsfreiheit, die Medienarbeit sowie Demokratiedefizite wie verschobene Wahlen.
Welche strukturellen Massnahmen wären nun im politischen System Österreichs gemäss der Autorin zu ergreifen? Tamara Ehs plädiert etwa für mehr parlamentarische Minderheitenrechte und dadurch ein neues Selbstbewusstsein des Parlaments gegenüber der Regierung, die Einrichtung von Bürgerräten als konsultative Erweiterung des repräsentativen Systems, die gesetzliche Verankerung und Konkretisierung der Informationsfreiheit und von Transparenzvorschriften, die Schaffung einer qualitätsorientierten Medienförderung oder auch die bessere personelle Ausstattung der demokratischen Institutionen. Im Grunde gehe es um «eine die Krise überdauernde Anerkennung von ‹mehr Staat› als Basis einer gerechten, auf Ausgleich bedachten Gesellschaft, die die sozialen Voraussetzungen von Demokratie» schaffe.
Der Essay ist auch aus Schweizer Sicht lesenswert, weil die meisten – aber nicht alle – demokratiepolitischen und rechtsstaatlichen Probleme auch hierzulande virulent geworden sind. Man fragt sich einzig, wieso Ehs in ihren Reformansätzen letztlich trotz allem ihren Blick vom rein repräsentativen System nicht auch hin zur direktdemokratischen Variante weitet – wenn nicht in Österreich, wo sonst?
 Andreas Kley: Verfassungsgeschichte der Neuzeit – Grossbritannien, die USA, Frankreich und die Schweiz (Stämpfli)
Andreas Kley: Verfassungsgeschichte der Neuzeit – Grossbritannien, die USA, Frankreich und die Schweiz (Stämpfli)
Andreas Kley (Professor für öffentliches Recht, Verfassungsgeschichte sowie Staats- und Rechtsphilosophie an der Universität Zürich) legt seine «Verfassungsgeschichte der Neuzeit» in vierter Auflage neu auf. Wie dem Untertitel zu entnehmen ist, konzentriert sich das Buch auf die Entstehung und Entwicklungen der Verfassungen Grossbritanniens, der USA, Frankreichs und der Schweiz. Dass gerade diese Staaten konstitutionell untersucht werden, ist natürlich kein Zufall, handelt es sich hier doch um die zentralen Schauplätze des «atlantischen Kreislaufs moderner Staatsideen», wie ihn vor geraumer Zeit Alfred Kölz in seiner Verfassungsgeschichte hervorgehoben hat. Konsequenterweise wurde so auch gegenüber der Vor-Auflage der Teil «Deutschland» weggelassen.
Verfassungsgeschichte, so Kley im einleitenden, eher anspruchsvollen Methodik-Teil, sei «immer auch politische Ideengeschichte». Jedoch sei sie «nicht der Ort für Superlative in dem Sinne, dass ein Gedanke oder die Idee einer Institution ‹zum ersten Mal› geäussert worden ist». Festzustellen, wer der Erste war, sei nicht sinnvoll, verlaufe die Rezeption von Ideen nicht in einer einzigen Richtung und gradlinig, sondern flächenartig vernetzt, und die Übertragungswege liessen sich nur schwer ausmachen. Kley hält sich daher wenig bei einzelnen Akteuren auf, zeigt dafür die Verfassungswerdung im jeweiligen aussen- und innenpolitischen und insbesondere sozialen Kontext auf.
Das Standardwerk ist aus einem Vorlesungsskript entstanden, das sich da und dort noch bemerkbar macht. So werden die einzelnen Teile jeweils mit einer übersichtlichen Zeittafel und einem Katalog aus anspruchsvollen Fragen abgerundet. Es richtet sich aber keineswegs nur an Jusstudenten, sondern an eine breite verfassungsgeschichtlich interessierte Leserschaft.
 René Roca (Hrsg.): Naturrecht und Genossenschaftsprinzip als Grundlage für die direkte Demokratie (FIDD)
René Roca (Hrsg.): Naturrecht und Genossenschaftsprinzip als Grundlage für die direkte Demokratie (FIDD)
Nachdem das Forschungsinstitut direkte Demokratie in einer ersten Trilogie von Konferenzen die Bedeutung von Katholizismus, Liberalismus und Frühsozialismus für die direkte Demokratie untersuchte, haben sich zwei weitere Tagungen dem Naturrecht sowie dem Genossenschaftsprinzip angenommen. Die wichtigsten Vorträge der letzten beiden Konferenzen sind im von Tagungsleiter und Historiker René Roca herausgegebenen Doppel-Tagungsband zu finden.
Das Naturrecht ist ein schillerndes Ordnungsprinzip mit Bezügen zur Philosophie, Recht, Ethik und Theologie. Der Begriff bezeichnet jenes Recht, das dem vom Menschen selbst geschaffenen Recht vorgelagert und übergeordnet ist – daher auch «überpositives Recht» genannt. Im Wesentlichen umfasst es jene Grundsätze, die für das menschliche Zusammenleben unabdingbar sind. Das Naturrecht, sei es religiös oder rational begründet, ist damit Vorläufer und Grundlage der Menschenrechte, aber auch des Völkerrechts. In ihren Vorträgen nähern sich Alfred Dufour, René Roca, Moritz Nestor und Christian Machek unterschiedlichen Aspekten des Naturrechts an. Hervorzuheben – der Tagungsort war schliesslich Neuchâtel – ist die Westschweizer Naturrechtsschule und ihr Vertreter Emer de Vattel, die im 18. Jahrhundert eine massgebliche Rolle spielten.
Eine weitere wichtige Grundlage für die Entstehung der direkten Demokratie der Schweiz ist das Genossenschaftsprinzip. Die jahrhundertealte Form kollektiver Selbstverwaltung verbreitete sich ursprünglich vor allem in voralpinen und Gebirgsregionen für landwirtschaftliche Zwecke (Allmenden, Alpkorporationen, Talgenossenschaften usw.), wie René Rocas Beitrag aufzeigt. Später, im Kontext der Industrialisierung erfasste die Genossenschaftsbewegung weitere Bereiche wie den Handel (Konsumvereine, heute Coop und Volg), den Wohnungsbau sowie das Spar- und Kreditwesen (Raiffeisen). Wolf Linder zeigt inhaltliche Parallelen zwischen dem Genossenschaftsprinzip und der direkten Demokratie auf: Beide «Aussenseiter-Systeme» fussen auf der Idee «Eine Person, eine Stimme», beide sind stark ans Lokale gebunden und stellen dadurch einen Kontrapunkt zur Hyperglobalisierung dar. Pirmin Meier durchforstet die Schweizer Literatur nach Referenzen zum Genossenschaftswesen und wird fündig bei Zschokke, Gotthelf, Keller und Federer.
 Martin Schaffner: Furcht vor dem Volk (Schwabe)
Martin Schaffner: Furcht vor dem Volk (Schwabe)
Martin Schaffner, emeritierter Historiker (Universität Basel), legt mit «Furcht vor dem Volk» eine Sammlung von acht Essays vor, die während 20 Jahren seines Schaffens zur Demokratiegeschichte Europas und der Schweiz entstanden sind. Im zentralen Beitrag «Direkte Demokratie: ‹Alles für das Volk – alles durch das Volk›» fokussiert Schaffner auf die drei Knotenpunkte der Schweizer Geschichte des 19. Jahrhunderts: die Umwälzungen von 1830/31, den Aufruhr von 1839–1841 sowie die Demokratische Bewegung(en) der 1860er Jahre. «Die Volksbewegungen der Jahre 1839–1841 wandten sich gegen die repräsentative Demokratie liberaler Prägung, wie sie nach 1830 in ihren Kantonen verwirklicht worden war, und gegen die Regierungen, die damals an die Macht gekommen waren.» Und schliesslich durchlief ab 1862 eine dritte Welle politischer Mobilisierung die schweizerischen Kantone, verlangten Tausende von Bürgern die Neuordnung der staatlichen Entscheidungsverfahren. Die Demokratische Bewegung habe damit das politische System der Schweiz in seiner noch heute bestehenden Grundform begründet.
Ein weiterer lesenswerter Essay «Rousseau und Condorcet über das Volk in der Französischen Revolution» stellt die beiden Demokratiekonzeptionen dieser zwei namhaften politischen Philosophen gegenüber. Dasjenige Condorcets «setzte auf die einzelnen Bürger, billigte ihnen individuelle Interessen zu und definierte Verfahren, durch welche aus unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Präferenzen ein staatlicher Gemeinwille entstehen, eine vernünftige Gesetzgebung entstehen konnten». Der Verfahrensdimension kam also zentrale Geltung zu, die Bürger sollten ihren Willen wirksam ausdrücken können; massgeblich war das Mehrheitsprinzip. Kontrastierend dazu stehe Rousseaus Demokratiemodell, das das Volk als homogenen politischen Körper betrachte und in dem Repräsentanten (also Parlamente) nicht vorgesehen waren.
In seinem letzterschienenen Aufsatz «Krise der Demokratie – Krise der Demokratiegeschichte» reflektiert Schaffner schliesslich die Historiographie und ihren Beitrag zum derzeitigen Demokratiediskurs: Er bedauert, dass die Einsichten, welche die hiesige Demokratieforschung der letzten Jahrzehnte erarbeitet hat, bisher keinen Widerhall in den aktuellen politischen Debatten gefunden hätten. – Das Fazit, das sich letztlich aus dem Werk von Martin Schaffner ziehen lässt, kann in seinen Worten wie folgt resümiert werden: «Nicht den liberalen und radikalen Eliten der Kantone und des Bundesstaats waren die Errungenschaften der Demokratie zu verdanken, sondern dem Druck von Volksbewegungen, welche Instrumente wie die Gesetzesinitiative und das Referendumsrecht gegen den Widerstand der Eliten erzwungen hatten.»
 Christian Moser: Der Jurakonflikt – Eine offene Wunde der Schweizer Geschichte (NZZ Libro)
Christian Moser: Der Jurakonflikt – Eine offene Wunde der Schweizer Geschichte (NZZ Libro)
Der 26. Kanton der Schweiz, der Jura, existiert seit 42 Jahren. Der damaligen Sezession vom Kanton Bern zugrundeliegende Jurakonflikt schwelt aber bis zum heutigen Tag an. Dies zeigt bereits die kürzliche Volksabstimmung in Moutier über den Kantonswechsel von Bern in den Kanton Jura, die aufgrund von unzulässigen Interventionen der kommunalen Behörden gerichtlich aufgehoben worden ist und 2021 wiederholt werden muss. Dieser «offenen Wunde der Schweizer Geschichte» nimmt sich Jurakenner Christian Moser in seinem Buch an, der als Journalist seit 1979 die Geschehnisse mitverfolgt.
Moser erzählt die Geschichte der Abspaltung und Kantonswerdung des Jura nicht traditionell chronologisch, sondern biografisch aus der Sicht von Marcel Boillat, dem schillernden Anführer der dreiköpfigen Terrororganisation Front de Libération Jurassien (FLJ). Die separatistische Bewegung – etwa die Jugendgruppe Béliers – trat ab den 1960er Jahren mit unzähligen spektakulären, öffentlichkeitswirksamen Aktionen in Erscheinung: So wurden nicht nur Berner Wappen entlang der Strassen des Berner Juras mit dem jurassischen Bischofsstab überpinselt, sondern auch einmal der Nationalratssaal gestürmt, Tramgeleise in Bern zubetoniert, Schweizer Botschaften in Frankreich und Belgien besetzt, Statuen niedergerissen oder der Unspunnenstein gestohlen (zuletzt 2005). Boillat und dem FLJ genügten derlei symbolische Aktionen jedoch nicht. Das Trio radikalisierte sich zusehends und schrak auch vor Brandstiftungen auf Bauernhäuser von Bern-Treuen und Sprengstoffanschlägen auf SBB-Geleise und die Berner Kantonalbank in Delsberg nicht zurück.
Vom Buch «Der Jurakonflikt» darf keine umfassende Gesamtschau über jegliche Aspekte der komplexen Geschichte um die Entstehung des Kantons Jura erwartet werden. Die akribische Recherche Mosers – von Gerichtsakten über Ratsprotokolle bis hin zu Interviews mit Boillat in seinem Exil in Spanien –, lässt die Leser aber in die polarisierende und bisweilen explosive Stimmung im Nordwesten der Schweiz eintauchen, die bis heute nachhallt.
 Stiftung für direkte Demokratie / Che Wagner / Daniel Graf / Philippe Kramer (Hrsg.): Macht Direkte Demokratie (buch & netz)
Stiftung für direkte Demokratie / Che Wagner / Daniel Graf / Philippe Kramer (Hrsg.): Macht Direkte Demokratie (buch & netz)
Im vergangenen Sommer wurde die «Stiftung für direkte Demokratie» gegründet, die neu hinter den digitalen Polit-Plattformen «WeCollect» (Online-Unterschriftensammlung), «Crowd-Lobbying» (Online-Lobbying) und weiteren Projekten der digitalen Demokratie steht. Da die Stiftung pandemiebedingt nicht wie intendiert eine physische Gründungsfeier durchführen konnte, haben die Herausgeber Che Wagner, Daniel Graf und Philippe Kramer stattdessen kurzerhand eine kleine Festschrift «Macht direkte Demokratie» innert wenigen Wochen aus dem Boden gestampft.
Die 39 Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Politik und Kultur zeigen darin in je einem kurzen Beitrag auf, wo und weshalb die hiesige direkte Demokratie ein Update benötige. Im ersten Themenblock «Ausbauen» werden neue Partizipationsformen wie deliberative Demokratie (Maximilian Stern, Linda Sulzer) oder E-Collecting propagiert (Sandro Scalco), jedoch etwa auch die E-Voting-Versuche stark kritisiert (Franz Grüter). Rahel Freiburghaus regt an, das Vernehmlassungsverfahren zu modernisieren und öffnen, ohne jedoch die damit einhergehenden Zielkonflikte ausser Acht zu lassen. – Der zweite Themenbereich «Teilhaben» widmet sich der Inklusion, also dem Zugang zur Demokratie und dessen Erweiterung: Ob Menschen mit Behinderungen, Ausländer, Frauen oder Junge, es gibt immer noch diverse soziodemografische Bevölkerungsgruppen, die einen reduzierten oder gar keinen institutionalisierten Einfluss auf die Demokratie haben. Dazu gehört aber auch die Chancengleichheit im demokratischen Prozess, der durch die oft höchst ungleich verteilten finanziellen Mitteln über Gebühr strapaziert wird (Marco Kistler).
Im dritten Teil «Neudenken» schliesslich werden Schlaglichter auf eine breite Themenpalette der Demokratisierung im weitesten Sinne geworfen: Philippe Wampfler skizziert eine Handvoll Grundsätze, wie Demokratiebildung in der Schule erfolgreich implementiert werden kann, während Elia Blülle dafür plädiert, den Wahltag statt als eher lustlos-formellen Behördengang als Volksparty zu zelebrieren. Auch hier werden aber nicht nur technologiegläubige Utopien präsentiert, sondern auch kritische Stimmen berücksichtigt, etwa zur politischen Macht der Daten (André Golliez) oder der «digitalen Militanz» (Michael Hermann).
Siehe auch:
Littérature napoléonienne – Buchempfehlungen 2019
Littérature napoléonienne – Buchempfehlungen 2018
Littérature napoléonienne – Buchempfehlungen 2017
Littérature napoléonienne – Buchempfehlungen 2016
Littérature napoléonienne – Buchempfehlungen 2015
Littérature napoléonienne – Buchempfehlungen 2014












 Martin Schaffner: Furcht vor dem Volk (
Martin Schaffner: Furcht vor dem Volk (




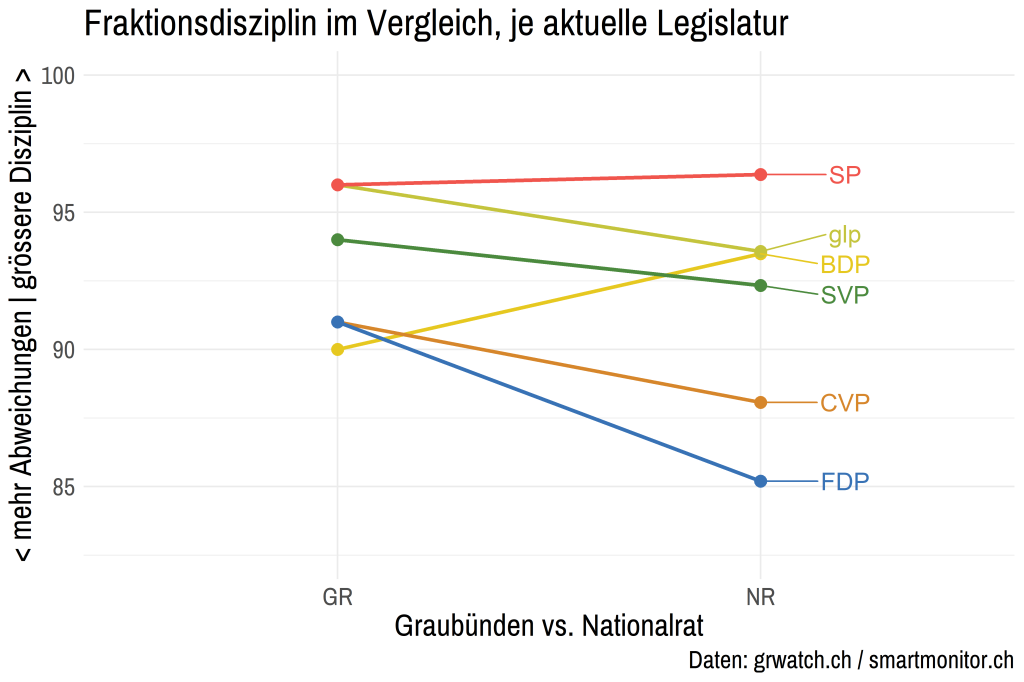







Recent Comments