«Ich sterbe, damit die andern leben», ziert eine Inschrift das Zürcher Rathaus. So, wie Kleinparteien, welche aufgrund der Zürcher Sperrquote aus dem kantonalen und städtischen Parlament verbannt werden.

Mitunter die EVP Stadt Zürich kämpft mit der 5-Prozent-Sperrhürde für den Einzug in den Gemeinderat.
In den vergangenen Jahren haben die Kantone Aargau, Zug und Zürich das doppeltproportionale Zuteilungsverfahren («Doppelproporz», «doppelter Pukelsheim») eingeführt. Dieses soll verhindern, dass kleine Parteien bei Parlamentswahlen durch zu hohe natürliche Quoren benachteiligt werden. Offen ist, ob die Politiker in diesen Kantonen den Sinn des Systems wirklich begriffen haben: Denn kaum wurden die hohen natürlichen Quoren eliminiert, ersetzten sie sie durch gesetzliche Quoren, die zu neuen Verzerrungen führen. Nur Listengruppen, welche in wenigstens einem Wahlkreis das jeweilige Mindestquorum erfüllen, werden daraufhin zur kantonsweiten Sitzverteilung zugelassen:
- Aargau und Zug: mindestens 5 Prozent Wähleranteil in einem Wahlkreis oder 3 Prozent kantonsweit
- Zürich: mindestens 5 Prozent Wähleranteil in einem Wahlkreis
Kommenden Sonntag bestellt nun die Stadt Zürich ihre Legislative neu. Analog zur Hürde für den Kantonsrat nimmt auch an der Sitzverteilung des Gemeinderats eine Partei «nur teil, wenn wenigstens eine ihrer Listen mindestens 5 Prozent aller Parteistimmen des betreffenden Wahlkreises erhalten hat».
Auschluss trotz Fraktionsgrösse
Diese Regel erscheint aus mehreren Gründen fragwürdig: Einerseits können dadurch Parteien von der parlamentarischen Mitwirkung ausgeschlossen werden, obschon sie einen bedeutenden Teil der Bevölkerung repräsentieren. Im Extremfall kann eine Partei mit einem mathematischen Sitzanspruch von sechs Sitzen den Einzug in die Legislative verpassen – eine Partei also, die eine eigene Fraktion bilden könnte. Die exklusive Zürcher «Hausordnung» mutet aber auch deshalb ironisch an, weil just dieses Gremium vor 11 Jahren den Anstoss zu den unterdessen schweizweit ergriffenen Wahlreformen gab. Das Bundesgericht bemängelte damals – was leider auch heute noch weitgehend zutrifft –:
«[H]ohe direkte Quoren bewirken […], dass nicht bloss unbedeutende Splittergruppen, sondern sogar Minderheitsparteien, die über einen gefestigten Rückhalt in der Bevölkerung verfügen, von der Mandatsverteilung ausgeschlossen werden. Aufgrund des Entscheides für das Verhältniswahlsystem dürften die eine Minderheitspartei wählenden Stimmbürger eigentlich darauf vertrauen, eine faire Chance auf einen Sitz im Gemeindeparlament zu haben.»
Die gebetsmühlenartig geäusserte Befürchtung einer «Parteienzersplitterung» ist geradezu absurd. Denn die elektoralen Prädispositionen, parteilichen Strömungen und soziopolitischen Präferenzen sind nun einmal dem Elektorat inhärent. Und diese – so die Maxime jedes Proporz-Zuteilungsverfahrens – sollten folglich kongruenten Niederschlag in der zu bestellenden Legislative finden. Zudem treten die Parteien in den Parlamenten ohnehin nicht als eigentliche Organe auf, es werden bekanntlich Fraktionen gebildet.
Vorgeschobene «Parteienzersplitterung»
So kommt auch in der Geschäftsordnung des Zürcher Gemeinderates das Wort «Partei» nur in Artikel 81 vor: «Mitglieder zweier oder mehrerer Parteien können eine gemeinsame Fraktion bilden.» Eliminiert werden sollte also nicht die Parteienzersplitterung – weil jene sowieso nicht ursprünglich verhindert werden kann, lediglich ihre Repräsentation –, sondern etwaig die «Fraktionenzersplitterung». Und diese wird dadurch verhindert, dass Fraktionen eine Mindestgrösse aufweisen müssen; in der Stadt Zürich (wie auch im Nationalrat) benötigen sie fünf Vertreter.
Darüber hinaus ist der Vorwurf einer «Parteienzersplitterung» geradezu unschweizerisch. Just hierzulande, in der vielgepriesenen Konsensdemokratie und Willensnation mit ihren mannigfaltigen kulturellen, geografischen, sprachlichen, religösen – mithin: politischen! – Minderheiten, sollte grosser Wert auf Einbindung aller manifester Strömungen gelegt werden. Da hierzulande auch keine Koalitionsregierungen gebildet werden müssen, die einer gewissen stabilen Mehrheit bedürften, können Sperrquoten in der Schweiz nur als undemokratisch bezeichnet werden.
Zuletzt ist das Heranziehen der «Parteienzersplitterung» als Begründung für Sperrquoten auch unehrlich. Denn in Wahrheit geht es den begünstigten Parteien nur um eines: Möglichst viele andere Parteien aus dem Parlament fernzuhalten, sprich: um Machterhalt und -optimierung. Die totalrevidierte Zürcher Verfassung sähe nunmehr vor, «die Sitzverteilung so zu regeln, dass der Wille jeder Wählerin und jedes Wählers im ganzen Kanton möglichst gleiches Gewicht hat.» Die postulierte Erfolgswertgleichheit bleibt für diverse Minderheiten eine Farce.
Gegenseitige Sprunghilfe der «E-Parteien»
Vom «Parteien-Mobbing» konkret bedroht sind am nächsten Sonntag insbesondere die EVP und die Schweizer Demokraten, welche bei den letzten Wahlen 2010 bloss haarscharf die Hürde meisterten: mit 5.01 beziehungsweise 5.02 Prozent im jeweils wählerstärksten Wahlkreis – je ein einziger Wähler weniger hätte das Aus bedeutet. Die EDU ging derweil leer aus, selbst in ihrer «Hochburg Kreis 12» errang sie bloss 2.74 Prozent. Neu tritt heuer die Bundesratspartei BDP sowie die Piraten/Konfessionslose an – auch ihr Eintrittstest erscheint unerfüllbar.
Die befreundeten Parteien EVP und EDU wenden nun aber einen erstmals beobachteten Trick an, der ihnen zum (Wieder-)Einzug ins Parlament verhelfen soll. Die EDU reichte im Kreis 9 keine eigene Liste ein und bittet stattdessen ihre dortigen Wähler, die EVP – in ihrem stärksten Wahlkreis – zu unterstützen. Das gleiche Spiel vice versa im Kreis 12: Hier verzichtet die EVP auf ihre Liste, um ihrerseits der EDU zum Erreichen der 5-Prozent-Hürde zu verhelfen. Addiert man die letzten Wähleranteile der zwei Kleinparteien, so könnte die Rechnung durchaus aufgehen:
| Gemeinderat Zürich: Wahlen 2010 |
EVP |
EDU |
«E-Parteien» kumuliert |
| Kreis 1+2 |
1.93% |
0.62% |
2.55% |
| Kreis 3 |
1.68% |
0.45% |
2.13% |
| Kreis 4+5 |
1.06% |
0.31% |
1.37% |
| Kreis 6 |
3.17% |
0.47% |
3.64% |
| Kreis 7+8 |
2.65% |
0.35% |
3.00% |
| Kreis 9 |
5.01% |
0.60% |
5.61% |
| Kreis 10 |
3.13% |
0.44% |
3.57% |
| Kreis 11 |
4.98% |
1.01% |
5.99% |
| Kreis 12 |
3.39% |
2.74% |
6.13% |
Die EDU-Rennleitung erwartet, «dass die EVP-Wähler im Kreis 12 die EDU-Liste wählen» werden. Es bleibt spannend, wie viele Wähler der takisch motivierten Order aus der Parteizentrale überhaupt Folge leisten werden. Und wie sich die Wähleranteile ganz allgemein verändern werden.
Weitere Optimierung und Mobilisierung möglich
Womöglich hätte der «gut-christliche» Pakt noch optimiert werden können und sollen. Denn auf der EVP-Liste im Kreis 9 treten «nur» EVPler an. Um den EDU-Sympathisanten die taktische Wahl der EVP-Liste noch schmackhafter zu machen, hätte man auf der Liste durchaus dem einen oder anderen EDU-Kandidaten Gastrecht gewähren können. Oder sogar eine abwechselnde «Zebra-Liste» aufstellen können. Dadurch würde das Elektorat der anderen E-Partei noch stärker mobilisiert. Schliesslich ist es nicht verboten, auf Parteilisten auch parteilose und parteifremde Kandidaten aufzunehmen. Das Analoge gilt wiederum für die «geschlossene Gesellschaft» der EDU-Liste im Kreis 12.

Smartmap der EVP und der EDU für die Zürcher Gemeinderatswahlen 2014.
Ein weiterer möglicher Kniff: Wahlkreis-fremde Zugpferde auf aussichtsreiche Listen transferieren. Denn wer in einem bestimmten Wahlkreis antritt, muss nicht zwingend auch dort wohnhaft sein; Wahlkreis und Wohnkreis dürfen divergieren. So wie Nationalrat Andreas Gross zwar in Zürich gewählt wurde, jedoch im Jura domiziliert ist. Eine komplett andere Strategie schliesslich wäre gewesen, im gesamten Wahlgebiet Kombi-Listen «EVP/EDU» zu verwenden, wie es die Piraten und die Konfessionslosen vormachen. Die EVP und die EDU hatten diese Variante in Betracht gezogen, jedoch verworfen.
Machtspiel der Grossen, Spielball der Kleinen
Doch so kreativ und verständlich solche Optimierungsszenarien auch sind, sie sind aus Sicht des Wählers intransparent und verzerrend. Denn trotz aller «christlicher Nächstenliebe» positioniert sich die EVP mitte-links, während die EDU klar rechtskonservativ ausgerichtet ist. Manch ein Wähler wird seine präferierte Partei nicht mehr wählen können, bloss weil er im falschen Wahlkreis wohnt. Im Gegensatz zum Aargau und Zug kennt Zürich keine alternative gesamtkantonale Sperrquote, wodurch Kleinparteien gezwungen werden, zu taktieren und «künstliche Hochburgen» und «Scheinehen» zu bilden.
Am Ende schafft es die eine oder andere E-Partei womöglich trotz Hürde wieder ins Parlament. Das Nachsehen haben indes die Wähler, die zum Spielball solcher taktischer Spielchen werden. Vor Einführung des Doppelproporzes musste ein EVP-Wähler im Kreis 12 befürchten, dass seine bevorzugte Partei nicht genug Stimmen holen würde, um das natürliche Quorum zu überwinden. Heute muss er nicht nur befürchten, dass die EVP das gesetzliche Quorum nicht schafft – er hat nicht einmal mehr die Möglichkeit, sie zu wählen.
Weitere aktuelle Artikel zum Thema:
Panne im Wahlbüro hat Folgen («NZZ», 28.02.14)
Piratenpartei: Stimmrechtsbeschwerde wegen 5-Prozent-Hürde («TOP Online», 24.02.14)
Mit Stimmrechtsrekurs gegen die 5%-Hürde (Medienmitteilung Piratenpartei Stadt Zürich, 24.02.14)
Die EVP ruft das Volk an – statt die Richter («Tages-Anzeiger», 22.02.14)
Zürcher EVP verzichtet auf Beschwerde nach Nachzählung («Radio TOP», 21.02.14)
Wahlen in Zürich: Die EVP ist definitiv nicht mehr im Gemeinderat (SRF Zürich Schaffhausen, 21.02.14)
Die Stadtzürcher EVP akzeptiert ihre Niederlage («NZZ», 21.02.14)
EVP sucht die politische Überzeugung statt den juristischen Kampf! (Medienmitteilung EVP Stadt Zürich, 21.02.14)
Erstaunliche Ungenauigkeiten im Wahlbüro Zürich 9 (Blog Andreas Kyriacou, 15.02.14)
Das Stimmvolk wollte es so («NZZ», 15.02.14)
Die EVP erwischt es in der Nachspielzeit («NZZ», 15.02.14)
EVP-Drama löst Systemdebatte aus («Der Landbote», 15.02.14)
«Es fragt sich, ob man nun nicht in allen Kreisen nachzählen müsste» (Interview Claudia Rabelbauer, «Der Landbote», 15.02.14)
Aus der Panne lernen («Tages-Anzeiger», 15.02.14)
EVP verliert alle Sitze im Zürcher Stadtparlament («Tages-Anzeiger», 15.02.14)
EVP ist traurig über Ihr Ausscheiden (Medienmitteilung EVP Stadt Zürich, 14.02.14)
Nachzählung in Zürich: EVP ist draussen (SRF Zürich Schaffhausen, 14.02.14)
EVP erreicht das 5%-Quorum nicht (Medienmitteilung Stadtrat Zürich, 14.02.14)
Hier wird nachgezählt («Tages-Anzeiger», 13.02.14)
Gemeinderatswahlen Zürich: Wieso die Nachzählung im Kreis 9 richtig ist und die 5%-Hürde Unsinn (Blog Andreas Kyriacou, 13.02.14)
Zürcher Wahlen: EVP kritisiert Nachzählungsentscheid scharf («Tages-Anzeiger», 12.02.14)
Vor der Nachzählung muss nicht nur die EVP zittern («NZZ», 12.02.14)
EVP muss nochmal zittern: Im Kreis 9 wird doch nachgezählt (SRF Zürich Schaffhausen, 12.02.14)
Stadtrat ordnet aufgrund äusserst knappem Resultat Nachzählung für den Gemeinderat im Kreis 9 an (Medienmitteilung Stadtrat Zürich, 12.02.14)
Trotz knappem Resultat: Die EVP hat ihre Sitze wohl auf sicher (SRF Zürich Schaffhausen, 12.02.14)
Die EVP muss noch zittern («NZZ», 10.02.14)
Eine einzige EDU-Stimme sicherte der EVP drei Sitze («Tages-Anzeiger», 10.02.14)
Zürcher Gemeinderat: So sind die Sitze verteilt («Tages-Anzeiger», 09.02.14)
FDP und AL gewinnen je 3 Sitze hinzu («NZZ», 09.02.14)
Das grosse Zittern der kleinen Parteien (SRF Zürich Schaffhausen, 04.02.14)
Wer zittern muss, wer hoffen darf («Tages-Anzeiger», 31.01.14)
Totgesagte sterben doch: Teil 2 – die EVP (Blog Andreas Kyriacou, 26.01.14)
Das grosse Zittern der kleinen Parteien («NZZ», 21.01.14)
Totgesagte sterben doch: Teil 1 – die Schweizer Demokraten (Blog Andreas Kyriacou, 08.12.13)
E-Kooperation in den Stadtkreisen 9 und 12 («NZZ», 02.10.13)





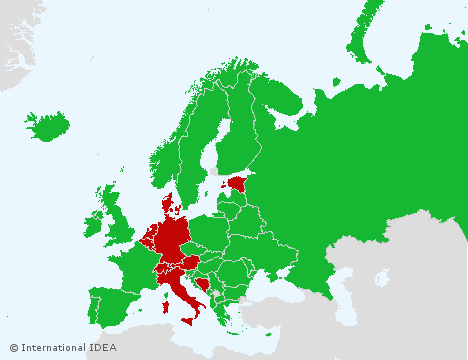







Recent Comments