Im März dieses Jahres hat das Bundesgericht entschieden, dass das Wahlsystem des Kantons Schwyz der Bundesverfassung widerspricht. Der Grund ist, dass der Kantonsrat nach dem Grundsatz des Proporz gewählt wird, die meisten Wahlkreise aber zu klein sind, um eine einigermassen proportionale Repräsentation im Parlament zu gewährleisten.
Mit dem negativen Befund der Lausanner Richter begannen die Probleme aber erst: Denn die neue Schwyzer Kantonsverfassung, die das Volk 2011 angenommen hatte, sieht genau das gleiche Wahlsystem vor. Weil der Bund die kantonalen Verfassungen auf ihre Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung hin zu prüfen hat, musste man sich somit auch in Bern mit dem Schwyzer Wahlrecht beschäftigen. Für den Bundesrat war klar, dass der Bund den entscheidenden Absatz im Artikel zum Wahlsystem, welcher der Bundesverfassung widerspricht, nicht akzeptieren kann. Die gleiche Meinung vertrat die Staatspolitische Kommission des Ständerats. Im Plenum war dann aber das Lobbying der Schwyzer Kantonsvertreter erfolgreich: Der Ständerat sprach sich dafür aus, die Kantonsverfassung vollständig zu gewährleisten. Als nächstes kommt das Geschäft in den Nationalrat. Der Schwyzer Kantonsrat hat inzwischen entschieden, die neue Verfassung trotz des Einwands des Bundesrats in Kraft zu setzen.
Im Prinzip ist der Fall klar: Die Kantone sind bei den Bestimmungen in ihren eigenen Verfassungen frei, sofern sie nicht gegen die Bundesverfassung verstossen. Im Bezug auf das Wahlrecht bedeutet das: Jeder Kanton kann grundsätzlich selbst bestimmen, nach welchem System sein Parlament gewählt werden soll. Die Bundesverfassung schreibt nicht vor, ob das Mehrheits- oder das Verhältniswahlsystem zur Anwendung kommen soll. Wenn sich ein Kanton allerdings für das Proporzsystem entscheidet, muss dieses garantieren, dass die Parteien auch wirklich gemäss ihrer Wählerstärke im Parlament vertreten sind – das Prinzip der unverfälschten Stimmabgabe muss gewährleistet sein.
Und hier beginnen die Probleme mit dem Schwyzer Wahlsystem: Weil jede Gemeinde einen Wahlkreis bildet, sind die Wahlkreise so klein, dass kleinere Parteien keine oder nur geringe Wahlchancen haben: Von 30 Wahlkreisen haben 27 weniger als 10 Sitze – so viele sind gemäss Bundesgericht nötig, um in einem Proporzsystem eine einigermassen faire Repräsentation zu ermöglichen.
In fast der Hälfte der Wahlkreise wird lediglich ein Sitz vergeben. In diesen Gemeinden wird das Majorzsystem angewendet – obwohl die Kantonsverfassung (im Gegensatz etwa zu jener des Kantons Uri) dieses mit keinem Wort erwähnt und ausschliesslich vom «Grundsatz der Verhältniswahlen» spricht.
Dass die Wahlkreise den Gemeinden entsprechen, führt ausserdem zu extremen Ungleichheiten der Stimmgewichte. So hat die Stimme eines Bürgers in Riemenstalden (87 Einwohner, 1 Sitz) etwa 26 mal mehr Gewicht als die eines Bürgers in Unteriberg (2300 Einwohner, 1 Sitz), was mit dem Gebot der Rechtsgleichheit kaum zu vereinbaren ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass in den Einerwahlkreisen eine besonders unfaire Form des Mehrheitssystems zur Anwendung kommt, wie Ständerat Hans Stöckli in der Debatte feststellte. Es handelt sich um die so genannte relative Mehrheitswahl, die vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet und dort als First-Past-The-Post-System bekannt ist.[1] Bei diesem System gewinnt in jedem Fall der Kandidat mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang, ohne dass es einen zweiten Wahlgang gibt. Derjenige, der den Sitz bekommt, hat also (anders als es die Bezeichnung «Mehrheitswahl» erwarten liesse) nicht zwingend die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, sondern im Extremfall deutlich weniger. Ein solches System benachteiligt kleine Parteien besonders stark und scheint schwerlich mit dem Prinzip der unverfälschten Stimmabgabe vereinbar, auch wenn sich das Bundesgericht dazu nicht geäussert hat.
Wie gesagt: Der Fall ist eigentlich klar. Die Debatte im Ständerat liess allerdings Zweifel darüber aufkommen, ob sich sämtliche Ratsmitglieder tatsächlich bewusst waren, worum es geht. Diskutiert wurde vor allem darüber, ob ein Mischsystem, das Proporz und Majorz kombiniert, mit dem Bundesrecht vereinbar ist. So ereiferte sich der Urner Standesvertreter Isidor Baumann:
«Es ist unverständlich, dass eine Mischung von Proporz und Majorz, die auf Verfassungsebene vorgesehen ist, nicht bundesrechtskonform sein soll.»
Tatsächlich ein solches System durchaus mit der Bundesverfassung vereinbar. Die Existenz eines Mischsystems an sich ist kein Problem, und es war auch nicht der Grund, weshalb sich der Bundesrat gegen die vollständige Gewährleistung ausgesprochen hatte, wie sich leicht feststellen lässt, wenn man die Botschaft der Regierung liest.
Reichlich konfus mutete das Votum des Schwyzer Ständerats Alex Kuprecht an, der zur Kritik an der relativen Mehrheitswahl Folgendes zu sagen hatte:
«Daher ist es, wenn in diesen Kleinstgemeinden nur eine Person antritt, die logische Konsequenz, dass halt nicht ein Proporzverfahren, sondern ein Majorzverfahren angewendet wird. Es ist völlig logisch, dass die Entscheidung dann im ersten Wahlgang getroffen wird.»
Das ist in der Tat völlig logisch. Kein Mehrheitswahlsystem der Welt sieht einen zweiten Wahlgang vor, wenn ein Kandidat bereits in der ersten Runde das absolute Mehr erreicht. Das ist aber eben nicht immer der Fall, und deshalb gibt es bei Majorzwahlen meist einen zweiten Wahlgang. Was das First-Past-the-Post-System kennzeichnet, ist, dass die Entscheidung immer im ersten Wahlgang fällt, egal, wie viele Stimmen der beste Kandidat dort holt.
Andere Ständeräte führten die kantonale Autonomie ins Feld und argumentierten, es gehe nicht an, dass sich der Bund in die Angelegenheiten der Kantone einmische. Der Wille der Schwyzer Bevölkerung sei zu respektieren, schliesslich habe eine deutliche Mehrheit Ja zur neuen Kantonsverfassung gesagt.
Auf den ersten Blick ist die Argumentation nachvollziehbar. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der Bund aus Respekt vor der Schwyzer Verfassung die eigene ignorieren soll. Immerhin wurde auch die Bundesverfassung einst von einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung angenommen (auch wenn die Schwyzer mehrheitlich Nein sagten).
Vor allem aber muss man sich fragen, welchen Sinn es macht, dass das Parlament Kantonsverfassungen gewährleisten muss, wenn eine Mehrheit offenbar der Ansicht ist, die Kantone bräuchten sich nicht ans Bundesrecht zu halten. Konsequenterweise müssten die Ständeräte, welche die kantonale Autonomie über alles stellen, die Abschaffung von Art. 51 Abs. 2 der Bundesverfassung fordern. Dass bisher kein solcher Vorstoss eingereicht wurde, sagt genug aus über die staatspolitische Glaubwürdigkeit jener Parlamentarier.
[1] Die Probleme des First-Past-the-Post-Systems kamen in diesem Blog schon einmal zur Sprache.
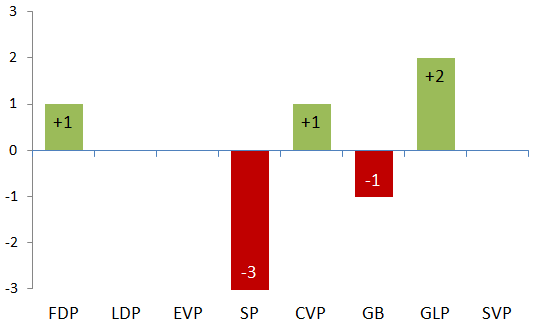
Recent Comments